Neueste Nachrichten aus Rostock und Warnemünde

Rostocker Volkstheater sucht neue Spielstätten
„Wir sind leider ausverkauft“ – dass so ein Satz aus dem Mund eines Theaterintendanten kommt, hätte sich der Chef des Rostocker Volkstheaters Peter Leonard auch nicht träumen lassen. Seitdem er und die Stadtverwaltung am Dienstag die Schließung des Großen Hauses bekannt geben mussten, wird nun fieberhaft nach Ersatz gesucht. Im Falle der Pinocchiovorstellung, die für nächste Woche geplant war, gestaltet sich die Suche nämlich schwierig. Ein Ort, wo ausreichend Plätze, eine gute Akustik und ein geeigneter Tanzboden vorhanden sind, muss erst einmal gefunden werden. Deshalb fällt die nächste Aufführung des Tanztheaters am Mittwoch aus. „Tänzer können nicht auf jedem Fußboden tanzen“, gibt Chefchoreograf Bronislav Roznos zu bedenken und nimmt die Entwicklung flexibel einsetzbarer Bühnenbilder als Herausforderung für die kommende Zeit an. Dennoch ist Peter Leonard zuversichtlich, für die meisten in dieser Spielzeit geplanten Vorstellungen Ersatzspielstätten zu finden, betont aber, dass diese in jedem Fall nur Provisorien sein können. „Wir hoffen, dass uns das Publikum trotz dieser schwierigen Situation weiter treu bleibt“, wünscht sich der Intendant. Solange es noch keinen neuen Geschäftsführer für die Theater GmbH gibt, hat er auch die kaufmännische Leitung übernommen. In den vergangenen Tagen war dies schon recht gut gelungen. So war das Konzert der Pasternack Big Band, die nach der Schließung des MOYAs im Volkstheater einen neuen Auftrittsort gefunden zu haben glaubte, im als Ausweichort genutzten Saal 2 der Stadthalle ausverkauft. Mit über 300 Besuchern war auch die gekürzte konzertante Version von Figaros Hochzeit in der Heiligen-Geist-Kirche fast so gut besucht, wie zuvor Karten reserviert und verkauft wurden. Eine gekürzte und konzertante Darbietung des Musicals „My Fair Lady“ wird es am kommenden Wochenende auch im Barocksaal geben. Die für den 4. März angesetzte Max-Gold-Lesung wird in den Mai ins Peter-Weiss-Haus verschoben. Corina Wenke vom künstlerischen Management kündigt weiterhin an, dass das 7. Philharmonische Konzert in der Nikolaikirche gespielt wird. „Es ist zwar akustisch nicht hundertprozentig günstig, aber akustisch gute Bedingungen haben wir eigentlich auch im Großen Haus nicht gehabt.“ Peter Leonard ergänzt: „Dieser Ort ist nicht ideal, auch hinsichtlich der Parksituation. Aber wir werden einen Transport organisieren.“ Die Premiere für „Tagträumer“ am 11. März wird im Katharinensaal der Hochschule für Musik und Theater gefeiert werden können. „Wir haben seit Jahren eine sehr freundliche Kooperation mit der HMT. Die Zugänglichkeit des Katharinensaals ist aber eingeschränkt, da sie selber so viele Aktivitäten haben“, schließt Peter Leonard eine Dauerpräsenz dort aus. Ähnliches gilt wohl auch für die Räumlichkeiten der Rostocker Stadthalle und der Hanse-Messe. Für eine Nutzung der Messehalle in Schmarl für jeweils zwei Wochen im März und April überprüft das Volkstheater derzeit die technischen Voraussetzungen. Vor allem größere Produktionen des Musik- und Tanztheaters sollen dorthin verlegt werden. Höchstwahrscheinlich wird hier auch die Premiere von „1st Dancework with Orchestra“ stattfinden – eine Produktion des Tanztheaters Bronislav Roznos, bei der die Norddeutsche Philharmonie sowohl akustisch, als auch visuell Bestandteil sein wird. Eine schwere Entscheidung ist auch der Umgang mit dem Stück Effie Briest, welches sich schon in der Endphase der Proben befindet. „Wir arbeiten an der Idee, dass wir die Premiere im Großen Haus aufführen und per Live-Stream im Internet ausstrahlen“, verrät Peter Leonard. Es ginge dabei weniger um Internettheater, dem dann das für das Theater wesentliche Live-Moment fehle, sondern vielmehr um einen geeigneten Abschluss der kreativen Arbeit, bevor man das Stück im Herbst dann vor Publikum aufführen könne. Kurzfristig scheint das Theater also Lösungen zu finden. Wie geht es aber in der nächsten Spielzeit im Herbst bis zur Einweihung des Theaterneubaus weiter? Im Moment liegen alle Vertragsverhandlungen auf Eis und auch der Druck des neuen Spielplans 2011/12 verzögert sich. Der Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ (KOE) rechnet derzeit mehrere Lösungsmöglichkeiten durch. Zum einen überprüfen Bauplaner, ob das Große Haus wieder bespielbar gemacht werden kann. Genaue Zahlen dazu werden für nächste Woche erwartet. Eine Brandschutzwand wurde schon vor einigen Tagen ins Foyer gebaut. „Ich finde die Idee nicht ganz klug, hier Geld zu investieren“, meint jedoch Peter Leonard und tendiert eher für eine Alternative. Diese sieht er in der Ertüchtigung der Halle 207 und dem Erwerb eines Theaterzeltes. Die Halle 207, die das Volkstheater schon seit zwei Jahren für das Sommerfestival nutzt, wird zwar für seine akustischen Qualitäten und die interessante Industriearchitektur gelobt. Alleine könne diese Spielstätte aber keine Dauerlösung für die nächsten fünf Jahre sein. Da sie nicht für größere dekorative Bühnenbilder geeignet sei, so der künstlerische Leiter des Volkstheaters Peter Leonard. Mit einem Zelt mussten auch schon andere Theater wie das in Magdeburg als Provisorium auskommen, allerdings nur für zwei Jahre. Bei der Standortfrage müssten aber Probleme wie Verkehrslärm und Sicherheit berücksichtigt werden. Peter Leonard geht davon aus, dass für ein Zelt mindestens ein sechsstelliger Eurobetrag investiert werden müsse. Die jeweiligen Kosten werden jetzt zusammengestellt, informiert Leonard. „Die Entscheidung treffen wir aber nicht, sondern die Stadt. Wir leisten nur die Zuarbeit, um ein Konzept vorzulegen.“ „Dass wir Einnahmeverluste aufgrund dieser Situation haben können, ist klar. Auch dass Mehrkosten entstehen, ist unabdingbar“, macht der Intendant deutlich. Der Wirtschaftsplan der Theater GmbH, von der die Stadt alleinige Gesellschafterin ist, ist aber nach der Schließung des Großen Hauses längst wieder hinfällig.
26. Februar 2011 | Weiterlesen
Ausstellung „Mein Land auf Leinwand“ im StALU MM
Wer würde schon damit rechnen, auf den Fluren einer Behörde von einer Flut bunter Kunstwerke begrüßt zu werden? Dabei seien eben diese eine beliebte Ausstellungsfläche, erzählt Anke Streichert. Sie ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALU MM). Nicht zuletzt wegen des regen Besucherverkehrs im Gebäude in der Erich-Schlesinger-Straße 35. So wurde also gestern schon zum 48. Mal neu dekoriert, wenn man so will. Bereits zum dritten Mal finden sich die Werke der Rostockerin Silke Tomasch an den Wänden. Vor acht Jahren hatte sie ihre Fotografien von Landschaften im Westen der USA im damaligen StAUN ausgestellt. Etwas später kam dann noch eine Fotoausstellung, diesmal zusammen mit ihrer Kollegin Birgit Müller-Klaes, mit Fotos aus der Natur unseres Landes. Als langjährige Freundin hielt Birgit Müller-Klaes dann auch eine kleine Rede zur Eröffnung der neuen Ausstellung. „Ihre Bilder sind unheimlich detailgetreu. Von Weitem sieht es aus wie ein Foto“, sagte sie. Und tatsächlich, wenn man sich zum Beispiel die Bilder der Kreideküste ansieht, so fühlt es sich fast an, als würde man einen Hauch Ostseeluft spüren. „Mein Anspruch ist es, alles realistisch zu malen“, erklärt Silke Tomasch. Hauptberuflich macht sie eigentlich aber etwas ganz anderes. Tagsüber ist sie im IT-Bereich des Finanzamts Rostock zu finden. „Ich male zum Ausgleich abends, um nicht vor dem Fernseher zu sitzen“, erzählt Silke Tomasch. Dass dabei eine so große Fülle an Bildern entstanden ist, ist wirklich erstaunlich. Noch viel erstaunlicher ist allerdings, dass sie sich alles selber beigebracht hat. Silke Tomasch malt hauptsächlich mit Öl auf Leinwand und verwendet dabei eine spezielle Nass-in-Nass-Technik. Es finden sich aber auch Bilder, die sie mit Acryl-, oder Aquarellfarbe gemalt hat. Auch mit Pastellkreide hat sie sich ausprobiert. Ihre Motive kommen fast immer von ihren Fotos, von denen sie rund 10.000 im Jahr knipst. „Wenn mir eins davon ins Auge sticht, dann male ich es auf Leinwand.“ Manchmal kommt es auch vor, dass sie ein Motiv aus vier Fotos zusammenstückelt. Außerdem verändert sie teilweise auch Dinge, die ihr an den Fotos nicht gefallen. „Auf meinen Bildern ist der Himmel immer blau“, verrät sie mir mit einem Grinsen. Wer realistische Naturmalereien mag, sollte sich unbedingt die Ausstellung im Gebäude in der Erich-Schlesinger-Straße 35 ansehen. Die Türen des Landesbehördenzentrums stehen dem Besucher von Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 17:30 Uhr und freitags immer von 09:00 bis 17:00 Uhr offen. Noch bis zum 24. Mai werden die Bilder von Silke Tomasch die weißen Wände der Flure im elften Stock zieren.
26. Februar 2011 | Weiterlesen
„Bella Italia“ auf der Ostseemesse 2011
Von A wie Autopflegemittel, über B wie Blumenzwiebeln bis Z wie Zitroneneis – auf der Ostseemesse scheint es alles zu geben, was Groß und Klein für den alltäglichen Bedarf so benötigen könnte. Das lockt natürlich auch zahlreiche Besucher in die Hanse-Messe nach Schmarl. Gleich am ersten Tag der Messe, dem Tag der offenen Tür mit freiem Eintritt, strömten etwa 15.500 Neugierige in die Verbraucherschau, so die Veranstalter von der Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft. Italien ist in diesem Jahr das Sonderthema der Ostseemesse. Und was verbindet man so mit diesem Land am Mittelmeer? Pizza, Pasta und Amore? Dafür war zumindest der singende Koch Rocco Giacobbe zuständig, der an den ersten drei Messetagen zu Melodien italienischer Schlager mediterrane Speisen zubereitete. Italienische Leckereien werden aber auch noch an vielen weiteren Ständen zur Verköstigung angeboten. Neben Oliven und Wein zählte natürlich auch Eis zu den Spezialitäten des Landes. Auf einem italienischen Oldtimer „zelebriert Andolini’s das Eis vom Stein“, wie es vom Eisverkäufer so schön heißt. Auf einem -16 Grad kalten Granitstein werden verschiedene Sorten Milcheis mit Früchten, Schokolade oder Waffeln angerichtet. Hierzulande vielleicht noch ein eher unbekannter Eisgenuss. Kurios auch die Cliptoes-Schuhe. Durch ein besonderes Druckknopf-Clip-Verfahren lässt sich der Stil der Damenschuhe mit verschiedenen Applikationen verwandeln. Morgens noch im schlichten Business-Look und abends dann zum glamourösen Auftritt – Seidenschleifen, Blüten oder aber auch Kunststoffspinnen und Rasierklingen machen es möglich. Mit zehn Farben und einer große Vielfalt an Clips kann Frau ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich ganz individuell ihren eigenen Schuh kreieren. Und wo werden die Schuhe gefertigt? Ja klar in Italien, aus Ziegenleder und einzeln von Hand versteht sich, informiert Detlef Müller von cliptoes. Italienische Tanzschuhe gibt es also auf der Ostseemesse, fehlt nur noch die passende Musik. Die gab es beim Bühnenprogramm in der Hanse-Messe. Neben vielen Bands und Kindertanzensembles präsentierte auch das Volkstheater Auszüge aus seinem aktuellen Spielplan. Das Ensemble des Musiktheaters mit dem Opernchor unter der Leitung des Intendanten Peter Leonard war am Eröffnungstag ebenfalls auf das Sonderthema der Ostseemesse eingestellt und präsentierte Melodien aus italienischen Opern. Auch die Blumenschau steht ganz im Zeichen von „Bella Italia“. Für das Mittelmeerfeeling sorgen Wein, Zitrus- und Lorbeerbäume. Aber auch über hundertjährige Olivenbäume wurden zwischen dekorativen Strohballen und Ziegelbrüchen mit antiken Figuren aufgestellt. Ebenfalls ein Hingucker sind die 500 roten Rosen, die das „Amore“ in die Messehalle bringen. Für die akustische Auflockerung wurde ein Verschlag mit Hühnern eingerichtet. Vielleicht gibt es hier schon mal das eine oder andere Osterei. Zwischen den 10.000 Frühblühern kommt jedenfalls schon mächtig Frühlingsstimmung auf. Die Messe kann noch bis Sonntag besucht werden. Die Veranstalter rechnen wieder mit insgesamt über 30.000 Besuchern. Damit gehört die Ostseemesse zu den attraktivsten Verbraucherschauen in Mecklenburg-Vorpommern.
26. Februar 2011 | Weiterlesen
Ausstellungseröffnung „Soundscapes“ im Haus Böll
Welche Geräusche definieren Rostock? Diese Frage stellte sich Barbara Alge, Juniorprofessorin für Ethnomusikologie an der HMT, eines Nachmittags. Im Rahmen der „Eurolecture“, einem Gastdozentenprogramm der Alfred Toepfer Stiftung, entstand daraus die Idee des Projekts „Soundscapes“. Zusammen mit Frances Wilkins, der Gastdozentin aus Schottland, und Studenten der Hochschule für Musik und Theater (HMT) wurde es dann in die Tat umgesetzt. Ein Semester lang – von Oktober bis Februar – wurden die Geräusche der Stadt aufgezeichnet. Von Straßenbahngeräuschen über Bauarbeitslärm, bis hin zu den Klängen der Straßenmusiker – alles wurde festgehalten. Die ganze Idee basiert übrigens auf den Theorien von Raymond Murray Schafer. Was klein anfing, nahm nach und nach immer größere Dimensionen an, erzählt Barbara Alge in ihrer Einführungsrede. Die Fachhochschule Wismar hörte von dem Projekt und wollte sich sofort daran beteiligen. Dank ihrer Hilfe entstand die Homepage www.soundscapesrostock.de, auf der man sich ab heute alle 110 Klangaufnahmen anhören kann. Außerdem hat die Fachhochschule Wismar das Layout der Poster gemacht, die in der Ausstellung zu sehen sind. Sie erklären dem Besucher, was hinter dem Projekt steht. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirke, erklärte Barbara Alge, stecke hinter der Anordnung der Poster doch ein System. Im Eingangsbereich wird dem Besucher der Kontext von „Soundscapes“ erläutert. Fragen wie, wer hat mitgemacht und wieso wurde es gemacht, werden hier beantwortet. Geht man weiter, folgen nähere Erklärungen zur Methode und den dahintersteckenden Theorien, sowie zur musikalischen Identität Rostocks. Hat man sich nun also die Basis erschlossen, geht es in den Raum der Studierenden. Hier haben sich die teilnehmenden HMT-Studenten ihre Gedanken gemacht und diese festgehalten. Themen wie die „Soundpolution“, also die Verschmutzung der Umwelt durch Geräusche oder die Visualisierung von Klang wurden von drei der teilnehmenden Studenten bearbeitet. Der letzte Teil der Ausstellung, im hintersten Bereich der Räumlichkeiten, bietet eine Vielzahl weiterer Themen. So wird zum Beispiel jeder Stadtteil Rostocks mit seinen eigenen Geräuschen dargestellt. Neben ein paar weiteren Elementen findet sich dort auch die Klanginstallation, die den Texten und Bildern die Hintergrundgeräusche liefert. „Es ist spannend aus diesem Blickwinkel die Stadt zu erkunden“, erzählt Iris Pitann, nachdem sie sich alle Poster angesehen hat. „Man ist ja eigentlich schon oft an diesen Orten gewesen, aber nie so gezielt.“ Auch der Student Daniel Wilke, der am Projekt mitarbeitete, erzählte mir, dass er nun bewusster durch die Straßen gehen könne. Er sagt aber auch, dass er ganz froh ist, nicht die ganze Zeit immer alles zu hören. Irgendwann würde es einfach stören. Außerdem war für ihn interessant, dass das Projekt auch einen methodisch/pädagogischen Ansatz in Augenschein nahm. Für ihn als angehenden Musiklehrer natürlich wie gemacht. Highlight des Abends war die Band „Hybrid Cosmics“, die sich ebenfalls aus Studenten der HMT zusammensetzt. Wie schon die Fachhochschule Wismar, waren sie von sich aus auf Barbara Alge zugekommen. Sie hatten den Plan, die gesammelten Tonaufnahmen in ein Musikstück zu verwandeln. Am gestrigen Abend stellten sie zum aller ersten Mal das Ergebnis vor. Eine Mischung aus Straßengeräuschen, Keyboard- und Gitarrensounds und denen eines Schlagzeugs. Die Musikstücke hatten sie zum Teil selber komponiert und zum Teil von bereits vorhandenen übernommen. Da sieht man also, dass uns vielleicht tagtäglich ein kleines Orchester aus Geräuschen entgeht, weil unser Gehirn sie ausblendet. Wer nun einmal bewusst durch Rostock laufen möchte, findet neben der Ausstellung auch eine Karte im Haus Böll (Mühlenstraße 9). Diese zeigt den Weg zu einem kleinen Klangspaziergang, auf dem man einmal genau hinhören kann. Die Ausstellung selbst ist noch bis zum 24. März geöffnet und kann kostenlos besucht werden.
25. Februar 2011 | Weiterlesen
Rostock Schwarzweiß. Karl Eschenburg und sein Rostock
„Wir eröffnen heute eine Ausstellung, die unsere Stadt zwar in schwarz-weiß zeigt, aber doch farbenfrohe Details präsentiert“, sagte Dr. Steffen Stuth, Leiter des Kulturhistorischen Museums. Auf 80 Fotografien und noch einmal 70 Bildern in einer Multimedia-Installation kann der Besucher das historische Rostock der zwanziger und dreißiger Jahre entdecken. So wird die Stadtgeschichte einmal auf eine ganz andere Art und Weise präsentiert. Teilweise inzwischen verloren gegangene Stadtansichten, aber auch altbekannte, sollen den Betrachter dazu bringen, bewusster durch die Straßen der Stadt zu gehen. Vielleicht auch einmal gezielt nach einem Motiv der Fotos zu suchen und sich die Frage zu stellen: Wie sieht das denn inzwischen aus? Wer käme zum Beispiel auf den Gedanken, dass sich dort, wo heute eine vierspurige Straße und ein großer Glaskasten das Stadtbild prägen, früher einmal ein großer Park befand? Das Bild vom Vögenteich ist wohl eins der besten Beispiele dafür, wie sich das Stadtbild über die Zeit veränderte. Natürlich fotografierte Karl Eschenburg (1900 – 1947) nicht nur Stadtansichten. Sein Hauptaugenmerk lag immer darauf, die Bürgerlichkeit der Stadt einzufangen. So fotografierte er zum Beispiel Arbeiter am Hafen oder das bunte Treiben in der Stadt. Es sind immer ungestellte Aufnahmen der Menschen und ihres Lebens. Besonders schön ist etwa ein Bild, auf dem ein Junge Luftballons hält. Eine Momentaufnahme, die für die Ewigkeit festgehalten wurde. Immer wieder wird einem beim Betrachten bewusst, was eigentlich verloren ging. Einige der abgebildeten Orte würden heute so nicht einmal mehr in Resten existieren, erzählt Steffen Stuth. Zum Beispiel ein Bild, das einen Teil der Stadtmauer zwischen Bussebart und Kanonsberg zeigt. Es liegt Schnee und Kinder rodeln die kleine Anhöhe hinter der Mauer runter. Heute befindet sich dort eine Straße. Aber nicht nur durch den Umbau der Stadt, sondern auch durch die Folgen des Kriegs, sind manche Orte komplett verändert. Besondere Perspektiven bekommen viele Bilder durch ihre Aufnahmeorte, für die Karl Eschenburg auch schon mal mit Plattenkamera und schwerem Holzstativ auf Kirchtürme und Kräne kletterte. Zum Glück fühlte sich Karl Eschenburgs Sohn, Wolfhard Eschenburg, immer der Archivierung aller Fotos, Abzüge und Glasplatten verpflichtet. Ohne ihn wären wichtige historische Zeugnisse vermutlich in der Versenkung verschwunden. Bereits 2005 hatte er die komplette Sammlung (rund 20.000 Bilder) an das Universitätsarchiv verkauft, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Er sei nicht froh darüber, die Bilder nun los zu sein, aber wenigstens habe er einen guten Partner gefunden, sagt er. Es handelt sich bei der Ausstellung um eine Zusammenarbeit zwischen dem Kulturhistorischen Museum und dem Archiv der Universität Rostock. Grundgedanke war es, die Arbeit des Archivs darzustellen und deren Wichtigkeit hervorzuheben. Das wurde auch in den Reden zu Beginn der Veranstaltung klar. Nachdem Steffen Stuth in seinen einleitenden Worten erzählt hatte, was die Ausstellung ausmache, schloss sich Karina Jens an. Sie verdeutlichte noch einmal, wie wichtig die Dokumentation des Vergangenen sei. „Karl Eschenburg ist einer der großen Chronisten, die Rostock und Mecklenburg-Vorpommern fotografisch festgehalten haben.“ Auch Professor Dr. Wolfgang Schareck, Rektor der Universität Rostock, richtete ein paar Worte an die Besucher. Die Bilder zeigten nicht nur die Architektur, sondern auch das herzliche Miteinander der Menschen, betont er. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich Menschen in alltäglichen Situationen fotografieren ließen. Bettina Kleinschmidt vom Universitätsarchiv versuchte den besonderen Charme der Schwarz-Weiß-Aufnahmen zu entschlüsseln. Vielleicht sei es die allgegenwärtige Überflutung von Farben in unserem Alltag, die es für uns so schön mache, die historischen Aufnahmen zu betrachten. Die letzten Worte des Abends richtete Wolfhard Eschenburg an die Besucher. Er brachte eine persönliche Note in die Ausstellung, als er den Werdegang seines Vaters erläuterte. Dem Zuhörer wurde klar, wie schwer es zu jener Zeit gewesen sein musste, Fotos zu machen. Noch dazu in diesem großen Umfang. Als dann die zahlreich erschienenen Besucher in die Ausstellungsräume strömten, hörte man an fast jedem Bild jemanden seine Überlegungen anstellen. Von wo wurde es aufgenommen? Was hat sich verändert? Auch die beiden Rostockerinnen Ingrid Forstreuter und Ingrid Faust kamen nicht umhin sich zu fragen, was sie als Kinder davon vielleicht schon einmal gesehen hatten. „Es ist ganz toll, so etwas, was man als Kind nicht erfassen konnte, hier zu finden“, erzählt Frau Forstreuter mir. Aber nicht nur für Rostocker ist die Ausstellung eine Bereicherung. Wer auch einmal Lust auf eine kleine Zeitreise hat, sollte sich die Ausstellung im Kulturhistorischen Museum auf keinen Fall entgehen lassen. Der Besuch ist kostenlos und von Dienstag bis Sonntag immer von 10 bis 18 Uhr möglich. Außerdem findet am 27. Februar um 11:00 Uhr eine erste Sonntagsführung statt. Erstmals wird es im Rahmen der Ausstellung auch Abendveranstaltungen geben.
25. Februar 2011 | Weiterlesen
Uni Rostock: Stiftungsprofessur Windenergietechnik
Bei einer schwachen Brise aus Südosten wurde gestern in der Universität Rostock der Vertrag für eine Stiftungsprofessur für Windenergietechnik unterzeichnet. Der in Rostock ansässige Windanlagenhersteller Nordex will diesen Lehrstuhl an der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik in den nächsten fünf Jahren mit insgesamt 1,25 Millionen Euro finanzieren. Derzeit wird eine internationale Ausschreibung vorbereitet, damit die Professur bis zum kommenden Wintersemester besetzt werden kann. Ab dem Sommersemester 2012 sollen sich dann auch Studenten für einen gleichlautenden Masterstudiengang einschreiben können. Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit der Windkraftanlagen sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser – das sind die technischen Herausforderungen, die Nordex nun gemeinsam mit der Universität angehen will. Derzeit beschäftigt sich das Unternehmen schon mit der Entwicklung neuer Schwachwindanlagen und einer neuen Generation von Offshore-Windrädern. „Bei so viel Forschung- und Entwicklungsaktivitäten sind wir auch zwingend darauf angewiesen, sehr eng mit einer Hochschullandschaft zusammenarbeiten zu können“, betont Nordex-Vorstandsvorsitzender Thomas Richterich. In Rostock sieht er dafür ideale Voraussetzungen. „Die Stiftungsprofessur sei jedoch nicht nur ein idealer Forschungspartner, sondern auch eine Bildungseinrichtung für den dringend gesuchten akademischen Nachwuchs“, so Thomas Richterich weiter, dem vor allem die anwendungsorientierte Ausrichtung des Lehrstuhls wichtig ist. So wolle man bei gemeinsamen Forschungsprojekten Labore und Testeinrichtungen zur Verfügung stellen. Immerhin verfügt Nordex bundesweit über den größten Teststand für Rotorblätter. Weitere Investitionen in diesem Bereich seien geplant. Eine hohe Attraktivität, auch für internationale Studierende, sieht Professor Dr. Egon Hassel, der mit etwa 20 Einschreibungen für den Masterstudiengang rechnet. „Die Windenergietechnik, die an den Bereich der Umwelttechnik grenzt, ist für die Studenten sehr lukrativ und wird intensiv nachgefragt“, schätzt der Dekan der Fakultät für Maschinenbau ein. „Dass wir heute in der Lage sind, in einem sehr innovativen Feld der Windenergietechnik eine Stiftungsprofessur einzurichten, ist in sofern etwas ganz Besonderes, weil wir nicht nur einen großen Forschungsauftrag bekommen, sondern damit im besten Sinne Forschung und Lehre miteinander verbinden“, betont Professor Dr. Wolfgang Schareck. Für den Rektor der Universität ist eine gute Lehre eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung marktfähiger Produkte und der Schaffung von Arbeitsplätzen für die Absolventen. „Wir haben die Hoffnung, dass wir dadurch junge innovative Ingenieure im Land halten und vielleicht auch Nachwuchs für Unternehmen der Branche generieren“, so Wolfgang Schareck. Die Idee für diese Stiftungsprofessur ist vor eineinhalb Jahren im Verein Wind Energy Network entstanden, dem etwa 80 Unternehmen die Windenergiebranche angehören. Zukünftig will man auch berufsbegleitende Studiengänge einrichten, denkt der Vereinsvorsitzende Andree Iffländer schon weiter. Die Stiftungsprofessur ist zunächst für fünf Jahre geplant. Danach hat sich die Universität verpflichtet, den Lehrstuhl zu verstetigen.
25. Februar 2011 | Weiterlesen
Schillers „Die Räuber“ im Theater im Stadthafen
Wenn Jungschauspieler ihre erste richtige Bühnenluft schnuppern, dann lernen nicht nur sie etwas davon, weiß Jörg Hückler, Schauspieldirektor und Chefdramaturg des Volkstheaters Rostock. Deswegen gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Koproduktion mit der Hochschule für Musik und Theater (HMT). So weht ein frischer Wind durchs Haus und die angehenden Schauspieler können von den alten Hasen lernen. Die diesjährige Inszenierung des Volkstheaters und der HMT steht im Zeichen der „Räuber“. In dem Drama von Friedrich Schiller geht es um einen Bruderzwist, der weitreichende Folgen hat. Während der Ältere in Leipzig studiert, schmiedet der Jüngere bitterböse Intrigen in der Heimat. Franz, der jüngere Bruder, ist neidisch auf seinen Bruder Karl, der reicher von der Natur beschenkt wurde als er. Er ist hübsch, hat die Frau, die Franz auch liebt und wird obendrein auch noch alles erben. Um diesen Missstand zu beheben, spinnt Franz ein Netz aus Lügen, die seinen Vater dazu bringen Karl zu verstoßen. Daraufhin wird dieser Hauptmann einer Räuberbande, um „den Armen zu helfen und die Unschuldigen zu rächen“, wie es im Programm heißt. Natürlich kommt es, wie es kommen muss, der Plan misslingt und die Räuber rutschen mehr und mehr ins Böse ab. Karl muss sich fragen: Ist es das, was ich wollte? Für die Schauspielstudenten der HMT ist es das erste längere Projekt. Bis jetzt spielten sie nur Zwanzig-Minuten-Stücke, erzählt Lysann Schläfke. Außerdem sei es das erste Mal, dass sie professionell arbeiten würden, berichtet Torsten Flassig weiter. Bisher mussten sich die Studenten immer alleine um alles kümmern. Bei dieser Produktion werden alle Arbeiten, wie die an Bühnenbild, Kostüm und Maske, für sie erledigt. „Am ersten Tag fühlte ich mich etwas verloren, mit so vielen Leuten, die an der Produktion beteiligt sind“, verrät mir Torsten. Natürlich unterscheidet sich die Welt des Theaters ein wenig von der der Hochschule. Es ginge nicht nur um die persönliche Weiterentwicklung, sondern auch ums Geschäft, sagt Samira Hempel. „Man macht das nicht nur für sich, sondern auch für den Zuschauer.“ Nichtsdestotrotz sind sich aber alle drei einig, dass sie sich den richtigen Beruf ausgesucht haben. „Es fühlt sich nach dem an, was ich später machen möchte“, sagt Torsten. Die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass zum ersten Mal der gesamte Jahrgang in einem Stück zu sehen sein wird. Bisher wurde immer in Gruppen geteilt. Schaut man sich nun aber die Liste der im Drama auftauchenden Rollen an, wird man eins bemerken. Zehn Schauspielstudenten und ein gestandener Schauspieler sind eigentlich ein paar Personen zu viel für die Hauptrollen. Samira aber erzählt, dass „jeder die Möglichkeit hat, seinen Moment zu haben“. Wie aber ist das möglich? Wer das herausfinden will, sollte sich unbedingt das Stück ansehen. Die Premiere findet am Freitag, dem 25. Februar, im Theater im Stadthafen statt. Wer dafür keine Karte mehr ergattern kann oder keine Zeit hat, der bekommt vielleicht an einem anderen Tag seine Chance das Geheimnis zu lüften. Im Spielplan vorgesehen sind weitere Vorstellungen am 01., 03. und 05. März, sowie am 07., 14. und 20. April.
24. Februar 2011 | Weiterlesen
Forschungsverbund entwickelt neuartige Gefäßstützen
Lösen sich teure Dinge einfach so in Luft auf, haben meist Langfinger ihre Hände im Spiel. Es bedeutet Ärger, Laufereien und wird oft zu einem Fall für die Versicherung. Ganz anders sieht dies bei einer neuen Generation von medikamentenbeschichteten Gefäßstützen – sogenannten Stents – aus, deren Entwicklung gestern in Warnemünde vorgestellt wurde. Dass sie sich, nachdem sie ihren Dienst getan haben, von selbst rückstandslos auflösen, ist nicht nur eine weltweit gefragte Neuentwicklung, sondern auch ein großer Schritt für die Herzmedizin. Für Professor Dr. Heyo K. Kroemer von der Universität Greifswald stellt die Entwicklung derartiger biomedizinischer Produkte einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der älter werdenden Bevölkerung dar. „Ein ganz überwiegender Teil der Probleme, die wir in den nächsten Jahren erleben werden, wird sich im Gefäßbereich abspielen. An allen Ecken und Enden wird bei den alten Herrschaften etwas zugehen, was wir mit den Stents offen halten können.“ Das beschränke sich langfristig nicht nur auf Herz und Gehirn, sondern schließt auch die Peripherie, wie die Beine, mit ein, so der Pharmakologe. Da es sich bei der Entwicklung dieser kleinen röhrchenförmigen Implantate, die im Falle von verengten Arterien eingesetzt werden, um ein hochkomplexes Produkt handelt, haben sich gleich mehrere Forschungseinrichtungen des Landes unter der Führung des Warnemünder Medizintechnikunternehmens Cortronik zusammengetan. Das 1998 gegründete Unternehmen erforscht und entwickelt vaskuläre Implantate und Stentdesigns. Auch mit den dazugehörigen Fertigungs- und Beschichtungstechnologien beschäftigt sich Cortronik. Schließlich handelt es sich bei diesen biomedizinischen Produkten nicht um Waren von der Stange. „Wir haben es hier mit einem Stent-Implantat zu tun, das an Komplexität gar nicht mehr zu überbieten ist“, stellt Dr. Carsten Momma von Cortronik fest. Bei dem Forschungsprojekt wird es deshalb unter anderem darum gehen, die Zeitabläufe der Auflösung der Gefäßstütze und des Medikamententrägers sowie die Medikamentenabgabe besser aufeinander abzustimmen. Außerdem will man die Medikamentenstents verbessern. Bisherige Probleme wie Brüche, unvollständige Medikamentenabgabe und unzureichendes Einwachsen, aber auch das Thromboserisiko sollen verringert werden. „Hierfür wollen wir einen speziellen Grundkörper entwickeln, der dann medikamentenfrei beschichtet wird. Das heißt, in diese Oberflächen sollen nano- oder mikroporöse Strukturen eingebracht werden, in denen das Medikament eingebettet ist“, erläutert Carsten Momma. Mit der Entwicklung dieser mikroporösen Oberflächenschichten wird sich die Fachhochschule Wismar beschäftigen. Die Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Mecklenburg-Vorpommern wird an den speziellen metallischen Legierungen und Kunststoffen arbeiten. Das Warnemünder Institut für Implantattechnologie und Biomaterialien wird für die Etablierung von Prüf- und Analyseverfahren zuständig sein. Die Universitäten werden sich mit dem Rostocker Institut für Biomedizinische Technik und dem Greifswalder Institut für Pharmakologie vor allem mit Grundlagenforschungen und Überprüfungen einbringen. Für das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 10,6 Millionen Euro, das auf drei Jahre angelegt ist, verteilte Wirtschaftsminister Jürgen Seidel gestern schon einmal Fördermittelbescheide in Höhe von insgesamt 6,1 Millionen Euro. Damit handelt es sich um das bislang größte Verbundforschungsprojekt seit 2007. „Sinn und Zweck unserer Verbundforschungsförderung ist es, den Fachkräften im Land Perspektiven aufzuzeigen. Hierzu gehören attraktive und wissensbasierte Jobs in Mecklenburg-Vorpommern“, betonte der Minister.
24. Februar 2011 | Weiterlesen
Projekt „Schule liest“ in Toitenwinkel gestartet
„Ihr werdet mit den Büchern nach Afrika kommen, nach Peru“, versprach Dr. Liane Melzer, Senatorin für Jugend und Soziales, Gesundheit, Schule, Sport und Kultur. Sie eröffnete gestern Morgen die Einführungsveranstaltung des Projektes „Schule liest“ in Toitenwinkel. Die gesamte Sporthalle war vollgepackt mit Schülern, die sich etwas ungeduldig anhörten, was denn die Erwachsenen zu erzählen hatten. Viel interessanter war natürlich die Band „Los Talidos“, die mit ihrer spanischen Musik für das musikalische Programm sorgte. Außerdem hatte die Klasse 2a der Schule unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Frau Pifrèment ein Programm einstudiert. Sie rezitierten Gedichte und sangen Lieder, allesamt zum Thema Buch. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen der „Grundschule an den Weiden“ und dem Literaturhaus Rostock. Ein ganzes Jahr lang sollen die Schüler interaktiv an Projekten teilnehmen und so die Lust am Lesen entdecken. Darüber hinaus geht es aber auch um die Vielfalt der Kulturen, die Umwelt und die Natur. Die Kinder sollen auf altersgerechte Art und Weise vermittelt bekommen, tolerant und hilfsbereit zu sein. Zu diesem Zweck werden im Laufe des Projekts sechs Autoren aus ihren Büchern vorlesen. Zusätzlich wird den Kindern die Chance gegeben, sich aktiv mit den aufgegriffenen Themen zu beschäftigen. So werden freie Mitarbeiter des Literaturhauses mit ihnen zahlreiche Projekte durchführen, wie zum Beispiel Rollenspiele oder Buchwerkstätten. Die Idee habe schon länger im Raum gestanden, erzählt Juliane Holtz, zuständig für die Projektleitung zur Leseförderung im Literaturhaus. Man wollte ein innerschulisches Projekt anschieben. Was fehlte, waren wie so oft die Gelder. Dass am Ende die Grundschule in Toitenwinkel ausgewählt wurde, hat mehrere Gründe. Zum einen war es dem Literaturhaus ein Anliegen, den Kindern den Zugang zu Kultur zu ermöglichen. Da die Schule nicht in der Innenstadt liege, sei es schwerer innerhalb der Schule Kultur zu entdecken, erzählt Gutrune Baginski vom Literaturhaus. In Toitenwinkel sei das Angebot einfach nicht vorhanden. Was natürlich auch nicht ungelegen kam, war die Förderung für Projekte im Stadtteil Toitenwinkel durch die „Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau“. Ein weiterer Förderer des Projekts ist unter anderem das Unternehmen „dm-drogerie markt“. Dieses hatte zusammen mit der Deutschen UNESCO-Kommission zum Wettbewerb „Ideen Initiative Zukunft“ aufgerufen. Das Literaturhaus hatte sich mit seinem Projekt „Schule liest“ dort beworben und durfte sich in einer der Rostocker Filialen präsentieren. In einer Auslosung entschieden die Kunden, dass die Förderung in Höhe von 1.000 Euro in das Leseprojekt fließen solle. So dürfen sich nun also Kinder, Lehrer und Mitarbeiter des Literaturhauses auf ein interessantes Jahr freuen. Genau wie die Bücher, denn wie Juliane Holtz in ihrer Rede sagte: „Bücher freuen sich am meisten darüber, mit Kinderaugen gelesen zu werden.“
23. Februar 2011 | Weiterlesen
Volkstheater Rostock: Schließung des Großen Hauses
Der letzte Vorhang ist gefallen, das Volkstheater Rostock schließt. Nicht ganz und nicht für immer, doch mindestens bis zum Ablauf der aktuellen Spielzeit Ende Mai muss das Rostocker Theater auf seine größte und wichtigste Spielstätte verzichten – das Große Haus. Hauptproblem sind die gravierenden Mängel beim Brandschutz. Bereits 1942 wurde das Große Haus zur zentralen Spielstätte, Mitte der 70er gab es die letzten großen Umbaumaßnahmen. Seit der Wende finden regelmäßige Brandschauen nach der Versammlungsstättenverordnung statt, erläuterte Bausenator Holger Matthäus. Alle dabei aufgezeigten Mängel seien immer umgehend beseitigt worden. So erfolgte etwa die Direktaufschaltung der Brandmeldeanlage beim Brandschutz- und Rettungsamt, Brandlasten wurden aus Fluren und wichtigen Räumen entfernt, es wird keine Pyrotechnik mehr verwendet und zusätzlich wurden Brandschutzhelfer an wichtigen Stellen im Volkstheater postiert. Nach den letzten Brandschauen sei jedoch eine Reihe baulicher und technischer Mängel festgestellt worden, die abgestellt werden müssen, um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. „Es kann nicht ausgeschlossen werden“, so Matthäus, „dass es im Brandfall zu Situationen kommt, die wir nicht beherrschen.“ Eine nicht mögliche Trennung in Brandabschnitte, fehlende Brandschutztüren und Rauchabzüge wurden ebenso bemängelt wie nicht vorhandene zweite Rettungswege bei einer Reihe von Nutzungseinrichtungen des Hauses. Aber auch auf den ersten Blick scheinbar kleine Probleme dürften erhebliche bauliche Maßnahmen nach sich ziehen. Offene Leitungsdurchbrüche in den Wänden sorgen laut Matthäus dafür, „dass wir die gesamte Elektrik im Haus anfassen müssen.“ Daher könne derzeit weder ein Zeitrahmen für den Bauablauf bestimmt, noch etwas zu den Kosten gesagt werden. Experten arbeiten derzeit an Lösungsvorschlägen. Die Summe dieser ganzen technischen und baulichen Mängel ist so groß, dass erhebliche Maßnahmen notwendig sind. Ein Weiterbetrieb, bei dem sichergestellt ist, dass nichts passiert, sei in der jetzigen Form nicht möglich, erläuterte der Bausenator. Es sei eine der schwersten Entscheidungen, erklärte auch Oberbürgermeister Roland Methling, doch „die Sicherheit der Besucher des Volkstheaters Rostock, die Sicherheit der Schauspieler und der Künstler in diesem Haus geht vor“, betonte das Stadtoberhaupt und legte Wert darauf, dass das Bekenntnis der Hansestadt Rostock zum Volkstheater bestehen bleibt. Auch wenn keine Einsturzgefahr für das Große Haus besteht, werden die Bühnen der größten Spielstätte des Volkstheaters Rostock in den nächsten Monaten leer bleiben. Das hat Konsequenzen – sowohl für den Spielbetrieb als auch für die Besucher. Bereits das für morgen geplante Konzert der Pasternack-Big-Band wird in die Stadthalle verlegt. „Wir bemühen uns um Ersatz, solange das Große Haus nicht bespielbar ist“, versichert Intendant und Geschäftsführer Peter Leonard: „Wir sind für Sie da!“ Karten und Abonnements behalten vorläufig ihre Gültigkeit. Und auch die Mitarbeiter des Volkstheaters müssen sich keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen, unterstrich Kultursenatorin Dr. Liane Melzer.
22. Februar 2011 | Weiterlesen
Rüdiger Fuchs: „Gombroman. Meine Dosis Polonium“
„Gombroman“, das ist nicht nur der Titel seines Buchs, sondern auch die Beschreibung des Autors selbst. Er sei gombroman, gibt Rüdiger Fuchs zu. Er habe sich fast schon manisch mit der Person Witold Gombrowicz beschäftigt. Fünf Jahre hat er damit verbracht, alles über den polnischen Autor herauszufinden und auf dessen Spuren zu wandeln. Herausgekommen ist ein Buch, das nicht so richtig ein Roman ist, aber eben doch ein bisschen. Der Autor selbst sagt, über die Form des Buches lasse sich streiten. Rüdiger Fuchs begann seine Lesung mit dem ersten Kapitel seines Buches. In diesem erzählt er, wie er überhaupt zu Gombrowicz kam. Er sei in einer nächtlichen Sendung des Deutschlandfunks über diesen Namen gestolpert. Auch wenn nichts von dem Gesagten in seinem Gedächtnis geblieben war, so doch eine Vorstellung. Die Vorstellung, dass die Werke Gombrowiczs hermetisch seien. Es schien bereits eine große, nach außen abgeschlossene Fangemeinde zu geben, der Fuchs unter keinen Umständen beitreten wollte. Sein Interesse aber blieb doch irgendwie bestehen und es reizte ihn herauszufinden, wie, nicht was, Gombrowicz schrieb. So habe er also immer wieder stichprobenartig in dessen Romane rein gelesen. Letztendlich muss der Stil dann ja doch eine gewisse Anziehungskraft auf ihn ausgeübt haben. Ansonsten hätte die gestrige Lesung im Peter-Weiss-Haus wahrscheinlich nicht stattgefunden. Nachdem Rüdiger Fuchs seinen ersten Ausschnitt beendet hatte, erzählte er ein wenig so über Gombrowicz. Dessen letzte Idee sei es gewesen, über Schmerz zu schreiben. Auch die darin auftretenden Personen hatte er bereits konzipiert. Ein Mann und eine Fliege. Bloß aufschreiben konnte er dies nicht mehr, da er vorher verstarb. Fuchs nutzte eben diese Idee als Inspiration für sein eigenes Werk. Nicht zuletzt das Titelbild – ein Mann mit einer übergroßen Fliege auf der Schulter – verrät genau diesen Hintergrund. Inwieweit dieses Thema in seinem Buch auftaucht, verriet Fuchs mit dem nächsten Ausschnitt, den er vorlas. Er entführt die Zuhörer in das „Institut für Nachhaltige Bioökometrisch-genomodigitale Insektenforschung“, das er in der Geschichte in Rostock angesiedelt hat. Der Fliegenforscher Goldbach beschäftigt sich in diesem Institut mit der Sprache der Fliegen. Dem Zuhörer präsentierte Fuchs einen Fetzen aus dem alltäglichen Laborleben, in dem man fast teilhat an der „Sternstunde der Fliegenlinguistik“. Kern der Handlung rund um Goldbach ist jedoch eigentlich dessen Lektüre eines Textes, der sich mit Witold Gombrowicz beschäftigt. Die Erzählung über Goldbach macht aber nur einen Bruchteil des Buches aus. Weitere Elemente sind Reiseberichte von Fuchs, die dieser auf den Spuren von Gombrowicz verfasste. Der Autor selbst erzählte, dass, wenn man sich fünf Jahre mit einer Person beschäftige, man automatisch „immer Verknüpfungen mit allem, was einen umgibt“ suche. So fanden also auch die Gedanken des Autors über dies und jenes ihren Weg auf die Seiten seines Buches. So erfuhr der Zuhörer zum Beispiel etwas über Fuchs‘ Ansichten zur Plastikverpackung von Hardcover Büchern und den kuriosen Zusammenhang mit ihrem Wert. Besonders diese Erklärung entlockte dem Publikum den ein oder anderen Lacher. Abgesehen davon finden sich noch viele weitere Beobachtungen in „Gombroman“, die sicherlich auch alle durchaus komisch sind. Die Prognose des Autors, es würden nach dem Lesen garantiert Fragen offenbleiben, kann ich nur teilweise zustimmen. Fakt ist, dass das Buch eine ungewöhnliche Fülle an Themen aufweist. Wie er selbst sagte, habe ihn diese Vielgestalt des Buches beim Auswählen der Kapitel in Schwierigkeiten gebracht. Damit es dem Leser etwas besser erginge, habe er sich eigens ein Leser-Leitsystem einfallen lassen. Jeder Bereich ist gekennzeichnet und so kann der Leser selbst entscheiden, ob er alles lesen möchte, oder nur ausgewählte Teile. Wer zum Beispiel keine Reiseberichte mag, könne diese einfach überspringen. Im anschließenden Gespräch mit Dr. Wolfgang Gabler vom Literaturhaus gibt er allerdings zu, dass der Leitfaden schon etwas ironisch gemeint war. Ihm als Autor wäre es natürlich am Liebsten, wenn das Buch von Anfang bis Ende in einem Stück gelesen würde. Außerdem habe er auch schon Rückmeldungen von Lesern bekommen, die die Benutzung des Leitfadens verwirrender fänden als die Lektüre in einem Stück. Aufgabe des Gesprächs sollte vor allem die Beantwortung etwaiger offener Fragen sein, die ja prognostiziert wurden. Man hatte jedoch oft das Gefühl, dass die Interpretationen von Gabler weitergingen, als die eigentlichen Gedanken des Autors. So bescheinigte Wolfgang Gabler Fuchs dessen „vollkommene Kompromisslosigkeit in seiner ästhetischen Radikalität“. Diese würde seine Liebe zur Literatur sichtbar machen. Darauf sagte Rüdiger Fuchs nur: „So radikal bin ich gar nicht.“ Er fühle sich natürlich geschmeichelt, aber die Radikalität sei nicht geplant gewesen. Dem Zuhörer wurde im Laufe des Abends klar, dass es viele Parallelen zwischen Gombrowicz und Fuchs zu geben scheint. Nicht zuletzt auch wegen der gemeinsamen Abneigung gegen jegliche Regeln und Normen. Fuchs sagt über sich selbst, all die Dinge, die man beim Schreiben nicht tun sollte, reizten ihn besonders. Er tue grundsätzlich genau das Gegenteil, fast schon zwanghaft. So erklärt sich also auch die unkonventionelle Form seines Werkes. Dem Leser jedenfalls wird das Buch, denke ich, eine Reihe an Lachern bescheren. Wer sich also von der Vielschichtigkeit noch nicht abgeschreckt fühlt und erfahren möchte, ob es Goldbach gelingt die Fliegensprache zu entschlüsseln, der sollte es unbedingt lesen. Als kleines Extra kann man auf der Internetseite des Charlatan-Verlags Fotos zu Rüdiger Fuchs Reiseberichten in Augenschein nehmen.
22. Februar 2011 | Weiterlesen
21. OstseeMesse 2011 in Rostock
Essen, Wohnen, Mode oder Freizeit – das Genießerherz wird ab kommendem Mittwoch wohl wieder höher schlagen, denn dann öffnet die 21. Ostseemesse ihre Pforten. Die Verbraucherschau zählt zu den größten Messen in Mecklenburg-Vorpommern. Auf einer Fläche von rund 10.500 qm werden 224 Aussteller in der Hanse-Messe in Schmarl ihre neusten Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Diese kommen nicht nur aus unserem und anderen Bundesländern, auch Unternehmen aus Tschechien, Polen, Österreich, den Niederlanden und Belgien haben den Weg nach Rostock gefunden. Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr dem Land Italien. So wird neben einer Gemeinschaftspräsentation auch die 9. Blumenschau unter dem Motto „Bella Italia“ stehen. Mit Zitrusfrüchten, Wein und Oliven wird das beliebte Reiseziel am Mittelmeer in den drei Bereichen „Küche, Liebe und Kultur“ floristisch dargestellt, verrät Katrin Kröber vom Blumenschau-Team. Auch beim Floristen-Wettbewerb zum Thema „Amore“ und „Viva Italia“ wird das Schwerpunktland der diesjährigen Ostseemesse wieder aufgegriffen. Italienischen Charme soll auch Rocco Giacobbe an den ersten drei Messetagen versprühen. Der „Vollblutitaliener“, wie er von Annett Liskewitsch von der Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft angepriesen wird, verbindet in seiner Show seine beiden Leidenschaften Kochen und Singen. Den Besuchern wird er Rezepte aus seiner Heimat nach Melodien von Eros Ramazotti und Adriano Celentano vortragen und die Speisen dabei natürlich auch gleich zubereiten. Der singende Koch aus Italien ist jedoch nur ein Höhepunkt des diesjährigen kulturellen Rahmenprogramms. Tanzdarbietungen von Rostocker Kinderensembles, Livemusik von regionalen Bands und Kostproben aus aktuellen Stücken des Volkstheaters sollen ebenfalls für Unterhaltung sorgen. Bewährt und bekannt auf der traditionsreichen Ostseemesse sind auch der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes Rostock, Modenschauen, die Aktionsstände mit „Radio und Fernsehen zum Anfassen" oder die Leselounge. Auch einen Kunsthandwerkermarkt und einen Kreativmarkt wird es geben. Bei Letzterem kann man gleich selbst die neuen Produkte ausprobieren und schöpferisch tätig werden. Für alle Sinne sollte es also vielfältige Anregungen geben auf der 21. Ostseemesse, die vom 23. bis zum 27. Februar in der Hanse-Messe in Schmarl stattfindet. Traditionell beginnt sie am Mittwoch mit einem Tag der offenen Tür, an dem der Eintritt für alle Besucher frei ist.
21. Februar 2011 | Weiterlesen
25 Jahre nach Tschernobyl – Menschen – Orte – Solidarität
Tschernobyl, das bedeutet übersetzt „dunkle schwarze Geschichte“. Und leider beschreiben diese Worte genau das, was sich am 26. April 1986 im Kernkraftwerk Tschernobyl ereignete. In Folge einer Kernschmelze und Explosion im Reaktorraum kam es zum Super-GAU. Bis heute gilt der Unfall als schwerste nukleare Havarie in der zivilen Nutzung der Atomkraft. Im April dieses Jahres jährt sich das Unglück bereits zum 25. Mal – und gerät zunehmend in Vergessenheit, insbesondere bei der jungen Generation, die die Zeit nicht selbst miterlebt hat. Genau an dieser Stelle setzt die Ausstellung „25 Jahre nach Tschernobyl: Menschen – Orte – Solidarität“ an, die gestern Nachmittag in der Werkstattschule in Rostock eröffnet wurde. Vor allem junge Menschen sollen für das Thema Atomkraft sensibilisiert und die Öffentlichkeit informiert und aufgeklärt werden, um zu verhindern, dass das Unglück in Vergessenheit gerät. Dabei ist den Ausstellungsmachern der persönliche Aspekt der Ausstellung besonders wichtig. Es geht nicht so sehr darum, alle Details des Unglückshergangs zu beleuchten, vielmehr soll das Schicksal der Menschen, die auch heute noch mit den Folgen zu kämpfen haben, in den Mittelpunkt gestellt und Solidarität geweckt werden. Mit Adam und Klaudia Waranets waren deshalb auch zwei Zeitzeugen persönlich anwesend, die nach dem Reaktorunfall als Liquidatoren eingesetzt wurden. Waranets erzählte, wie die Regierung der ehemaligen Sowjetunion die Bevölkerung für ganze zwei Wochen in Unkenntnis gelassen und anschließend nur die Kinder evakuiert hatte. Damals glaubten die Staatsoberhäupter noch, die Folgen der Katastrophe durch einfache Aufräumarbeiten neutralisieren zu können. Eine fatale Fehleinschätzung, denn tatsächlich sind die Folgen heute lebendiger als vor 25 Jahren. Folgen, an die Waranets tagtäglich erinnert wird, da auch seine Kinder und Enkelkinder an Schilddrüsenkrankheiten leiden. „Wir hätten die Ausstellung auch 25 Jahre Tschernobyl nennen können, denn es ist noch nicht vorbei“, erinnerte auch Ausstellungsmacherin Sabrina Bobowski vom Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund (IBB) an die langfristigen Schäden, die durch die Katastrophe entstanden sind. Ursula Timm vom Verein Ferien für Kinder von Tschernobyl hob in ihren einleitenden Worten ebenfalls den persönlichen Aspekt der Ausstellung hervor: „Es geht nicht nur um die Erinnerung, sondern auch um die Verbundenheit mit den Menschen.“ Schließlich sind es von hier aus gerade einmal 1.400 km bis nach Tschernobyl – viel näher als es vielen wahrscheinlich bewusst ist. Des Weiteren betonte sie aber auch, dass es darum gehe, „Zeichen zu setzen, gegen die Gleichgültigkeit der Energiepolitik“, da das Thema Atomkraft nicht zuletzt durch die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in Deutschland aktuell ist wie lange nicht mehr. „Wir haben den Eindruck, dass Tschernobyl aus den Diskussionen um die Zukunft der Energieversorgung bewusst herausgehalten wird“, äußerte sich Sabrina Bobowski in ähnlicher Weise. Allerdings unterstrich sie auch, dass Tschernobyl ein Thema sei, das vielen Menschen parteiübergreifend ein Anliegen sei. So ein Mensch ist beispielsweise Dr. Helga Knopf, die an der Werkstattschule Physik unterrichtet und die sich mit dafür verantwortlich zeichnet, dass die Ausstellung in den Räumlichkeiten der Schule stattfindet. Im Rahmen ihres Unterrichts behandelt sie regelmäßig das Thema Kernphysik, wobei sie zu bedenken gab, „dass es nicht ausreicht, das Thema nur von der Physik her anzugehen, sondern auch von der Ethik.“ Das Konzept der Ausstellung stellt eine Kombination aus Sach- und Fotoausstellung dar, die durch zahlreiche Filmausschnitte und Zeitzeugenberichte ergänzt wird. Darüber hinaus können eine Broschüre mit allen Informationen sowie ein Fotoband erworben werden. Wer die Ausstellung besuchen möchte, sollte sich beeilen, denn sie wird nur bis zum 25. Februar zu besichtigen sein. Darüber hinaus haben die Veranstalter für jeden Tag weitere interessante Programmpunkte organisiert. So wird es heute den Film „Tschernobyl – der atomare Schrecken“ von Bernd Dost zu sehen geben, inklusiv anschließendem Filmgespräch. In den nächsten Tagen wird es einen Vortrag mit anschließender Diskussion über das Für und Wider zur Atomkraft, Berichte und Gespräche mit Zeitzeugen, eine Dokumentation zum Thema Atommüll und einen Nachmittag der Begegnung mit Tschernobyl-Initiativen aus Mecklenburg-Vorpommern geben. Der Eintritt ist übrigens kostenlos.
21. Februar 2011 | Weiterlesen
3. Electrocution Festival im M.A.U. Club
Ganz im Zeichen elektronischer Musik stand der M.A.U. Club am gestrigen Abend. Zum dritten Mal wurde dort das Electrocution Festival ausgetragen. Fünf Bands und zwei DJs waren angetreten, um die Tanzfläche zum Kochen zu bringen. Den Anfang machten EDriver 69, die zum ersten Mal beim Electrocution Festival auftraten. Musik machen die drei Wahlberliner allerdings schon seit 15 Jahren. Ihren Stil beschreiben sie als „EBM mit ein bisschen mehr Groove. Nicht einfach nur Four to the Floor.“ Auf die Frage, was man von ihrem Auftritt an diesem Abend erwarten könne, antworteten sie nur: „Wir wollen heute einfach mal die Sau raus lassen. Einfach Spaß haben.“ Eine Vorgabe, die offensichtlich aufging, da das Publikum von Anfang an gut mitging. Nach einer kurzen Umbaupause betraten anschließend „Prager Handgriff“ die Bühne, ein Projekt, das bereits seit Anfang der 90er Jahre existiert und in diesem Jahr ein neues Album herausbringt. Mit ihrem ersten Song legten sie die Marschroute für den weiteren Abend fest und erklärten das M.A.U. zur Elektrorepublik. Mit den Schweden von Container 90 wurde es anschließend etwas punkiger. Die Band, die von Projekten wie der Deutsch Amerikanischen Freundschaft beeinflusst ist, vereint den EBM Stil mit Elementen aus Punk und Hardcore „Die Punk Attitüde ist sehr wichtig für uns“, betonten sie. Nach dem folgenden Auftritt von Mastertune bildete mit Absolute Body Control ein echtes Urgestein elektronischer Musik den Abschluss des Abends. Das Projekt der beiden Belgier Dirk Ivens and Eric Van Wonterghem existiert bereits seit Ende der 70er Jahre. Nach der Trennung in den 80ern folgte vor einigen Jahren die Reunion und ein neues Album namens „Shattered Illusion“. Wer dann noch nicht müde war, der konnte bei der anschließenden Party mit DJ Drill und Matze noch bis in die Morgenstunden weiterfeiern.
20. Februar 2011 | Weiterlesen
Verleihung des Projektpreises HMT-Interdisziplinär 2011
Mal über den Tellerrand schauen und sich nicht in seinem gewählten Studienfach einigeln, davon sollen auch Studierende der Hochschule für Musik und Theater (HMT) profitieren. Um hochschulinterne, institutsübergreifende Projekte zu fördern, hat die Hochschule dafür den Wettbewerb „HMT Interdisziplinär“ ins Leben gerufen. Bereits zum fünften Mal brachten Studierende aus den drei Instituten der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Schauspiel, Musik und Musikpädagogik/Musikwissenschaften gemeinsam ein Stück auf die Bühne. In diesem Jahr traten insgesamt 31 Studierende mit sieben Projekten an. Der Clou an der ganzen Sache: Sie mussten alle ohne die helfenden Hände ihrer Dozenten arbeiten. Eine weitere Teilnahmebedingung war, dass Studenten aus mindestens zwei Instituten innerhalb einer Gruppe vorhanden sein mussten. Als Belohnung für ihre mehrmonatige Zusammenarbeit winkten Preisgelder von insgesamt 6000 Euro. Am Samstagabend wurden schließlich im Katharinensaal der HMT die Preise an die drei Erstplatzierten verliehen. Auch zwei Sonderpreise hatte die Jury, die sich hauptsächlich aus Hochschullehrern zusammensetzte, zu vergeben. Einer davon wurde für eine „hervorragende Projektidee“ verliehen, und zwar an das Projekt „Ehre deinen Vorgesetzten“. Zum Zweiten wurden die Auszubildenden der Bühnentechnik geehrt, für ihre künstlerische Mitarbeit bei den Stücken. Die eigentlichen Premieren aller Stücke hatten bereits in den vorangegangenen Tagen stattgefunden. Nach der Preisverleihung am Samstag wurden jedoch noch einmal die besten drei Stücke präsentiert. Den zweiten Platz teilten sich zwei sehr unterschiedliche Projekte. Im Nachhinein betrachtet kann man vielleicht sagen, dass beide einen Kampf zum Thema hatten. Während es bei „UBU ROI“ um den Machtkampf ging, stand bei „Das Quaken einer Ente erzeugt kein Echo“ der Kampf mit der Unsicherheit im Vordergrund. Dabei hatten beide Gruppen einen ganz unterschiedlichen Weg der Darstellung gewählt. Bei „UBU ROI“ geht es kurz und knapp gesagt darum, dass Vater UBU auf Drängen seiner Frau den König von Polen stürzen will. Als ihm das gelingt, nutzt er seine Macht aus, um sich ein bequemes Nest zu bauen. Dafür trifft er Entscheidungen, die allen anderen nicht gefallen, wird sogar zum Tyrannen. Die Lösung des Problems, er muss ebenfalls abgeschafft werden. Das Theaterstück basiert auf einer viel längere Originalfassung des französischen Schriftstellers Alfred Jarry. Dass gekürzt wurde, fiel jedoch nicht auf, denn das Ergebnis machte die Aussage trotzdem deutlich und wirkte nicht unvollständig. Besonders die interaktive Einbeziehung des Publikums war sehr gelungen. So war der Satz aus dem Programm – „Kommen Sie hoch auf die Bühne!“ – kein Scherz. Ein Teil des Publikums fand seine Plätze tatsächlich direkt neben der Bühne und musste seinen Teil zur Vorführung beitragen. Ganz ohne Hilfe des Publikums kam das Stück „Das Quaken einer Ente erzeugt kein Echo“ aus. Es kam ohnehin viel ruhiger und nachdenklicher daher. Die meiste Zeit über stand einer der Studenten auf der Bühne und hielt einen Monolog, der es jedoch immer in sich hatte. Es ging um die Unsicherheit, die sich in unserer heutigen Gesellschaft immer häufiger zur Hintertür hineinschleicht. Dabei lag der Fokus darauf, zu zeigen, in welcher Verkleidung dieses Gefühl auftauchen kann. Mal kommt es aus einem Selbst und gleich im nächsten Moment überfällt es einen von außen. Auf eindrucksvolle Weise wurde dem Zuschauer das Gefühl der Angst nahe gebracht. Man konnte es nachvollziehen, denn auch wenn nur in Teilen, so fand man sich doch irgendwo wieder. Der Eine in den so schön klingenden Beschreibungen der Vergangenheit. Der Nächste in der von zu vielen Informationen angefüllten Welt, in der wir ständig über das Handy erreichbar sind und es sein müssen. Am Ende des Stücks plädierten die Studenten dafür, dass eine Katastrophe passieren müsse. Sie sagen, es gäbe zu viele Menschen auf dieser Welt, um noch etwas Besonderes zu sein. Den Abschluss bildete eine Wand aus Pappkartons, von denen jeder Einzelne die Aufschrift „Quak“ trug. Was die Gleichplatzierung der beiden Stücke anging, war das Publikum anscheinend unterschiedlicher Meinung. Gabriele Prechtel sagte: „Ich fand das erste Stück besser, weil es viel lebendiger war.“ Ihr Mann, Walther Prechtel, sah das etwas anders: „Ich fand beide gut, für mich gab es kein Ranking zwischen den Stücken.“ Auf die Siegergruppe waren beide gleichermaßen gespannt, so wie wohl alle, die nach der Pause wieder zurück in den Katharinensaal strömten. „Brüderchen, komm tanz mit mir …“ wird wohl für alle Zuschauer nie wieder nur ein Kinderlied sein, wage ich zu behaupten. Denn in dem gleichnamigen Siegerstück haben dieses Brüderchen und Schwesterchen nicht mehr viel gemeinsam mit dem unschuldigen Lied. Schon als Kindern wurde Elisabeth und Paul gesagt, sie kämen sofort in die Hölle, wenn sie sich irgendwie körperlich nahe kämen. Gleich in der ersten Szene dachte man, man hätte ein Paar vor sich auf der Bühne. Gleich darauf erfuhr man aber, dass es sich um Bruder und Schwester handelte. So vergaß man kurz den ersten Eindruck, natürlich nicht für lange. Denn immer wieder wurde man darauf gestoßen, dass zwischen den beiden mehr ist, als da sein sollte. Zu allem Überfluss verstrickten sich dann aber auch andere Personen in diese unerlaubte Liebe. Immer wieder bot sich den Geschwistern die Flucht aus ihrer eigenen kleinen Welt, in der sie sich versteckten. Und doch endete das Stück letztlich mit ihrem Tod. Freiwillig, um sich endlich richtig nahe sein zu können. Mir kam es so vor, als wären die unausgesprochenen Dinge viel wortgewaltiger als die, die wirklich gesagt wurden. Und die Kleinigkeiten, wie die Auswahl der Kostüme, waren die eigentlich großen Dinge. Alle vier Studenten trugen die gleichen roten Shorts und blauen T-Shirts. Von Zeit zu Zeit wurde dann allerdings auch mal eine Jacke darüber gezogen oder eine Hose übergestreift. So konnte man zu jeder Zeit sehen, wer sich gerade in welcher Welt aufhielt. In der Elisabeth-und-Paul-Welt oder außerhalb davon. Zugehörig zu einem der beiden oder losgelöst. Man kann im Großen und Ganzen also sagen, es war ein sehr gelungenes Projekt, bei dem viele schöne Momente entstanden sind. Axel Meier, ein Erstsemester der Hochschule, könne sich nach seinem Mitwirken bei „UBU ROI“ durchaus vorstellen wieder mitzumachen, verrät er mir. Man darf also auch im nächsten Jahr wieder gespannt sein, wenn die HMT zur Verleihung des Projektpreises ruft. Wer weiß, was den Zuschauer dann wohl alles erwartet.
20. Februar 2011 | Weiterlesen
Das Zigeunerlager zieht in den Himmel
„Das Zigeunerlager zieht in den Himmel“ ist eigentlich ein russischer Film aus dem Jahr 1976, in dem es um eine tragische Liebesgeschichte zwischen einem Zigeunermädchen und einem Pferdedieb geht. Allerdings dienten der Film und die zugehörige Musikproduktion ebenfalls als Vorlage für Natascha Osterkorns gleichnamiges Konzertprogramm, mit dem sie gestern Abend auch in Rostock gastierte. Dabei stellte Osterkorn, die als Kind bei ihrer Großmutter, einer Roma-Zigeunerin, aufgewachsen ist, auch ihre mittlerweile dritte CD „Always happy“ vor. Bis auf den letzten Platz war die Bühne 602 gefüllt, als die studierte Pianistin mit ihren beiden Mitstreitern Vadim Kulitzkii (Gitarre) und Oljek Matrosov (Gitarre und Balalaika) die Bühne betrat. „Wir freuen uns sehr, dass Sie zum Lagerfeuern gekommen sind“, begrüßte sie zunächst das Publikum, bevor es auch gleich mit dem ersten Stück losging. Schließlich mag Natascha Osterkorn keine Ruhe. Gespielt wurden traditionelle russische Zigeunerlieder, in denen es, passend zur Handlung des Films, meistens um tragische, mal um glückliche Romanzen und natürlich die Liebe an sich geht. „So ist das bei Zigeunerliedern. Fast alle Lieder sind über die Liebe“, klärte die Sängerin das Publikum über den Inhalt der Lieder auf. Und so erfährt man im Laufe des Abends beispielsweise, was ein Zigeuner bei minus 40 °C nachts im Wald macht. Irgendeine Idee? Nein? Er sucht natürlich seine Frau. Oder dass ein Zigeuner, der heiraten möchte, zunächst sehr lange eine Frau sucht. Findet er sie schließlich, geht alles ganz schnell und es wird sofort geheiratet – manchmal auch ohne zu fragen. Vor jedem Lied erzählte Natascha Osterkorn kleine Anekdoten über deren Inhalt und entlockte dem Publikum damit einige Lacher, nicht zuletzt weil ihre beiden Mitmusiker auch schon mal als Vögelchen oder Pferd in die Geschichten eingebaut wurden. Langeweile kam jedenfalls zu keinem Zeitpunkt auf, auch weil die drei Musiker mit so viel Spielfreude auftraten, dass sie das Publikum im Handumdrehen für sich gewannen. Und was sagte Letzteres nun zum Konzert? „Ich habe sie schon mal gesehen und finde sie klasse“, äußerte sich Karola Schlemmer während der Pause. Für Viola Straube war es ebenfalls ein gelungener Abend: „Ich bin begeistert. Ich bin hundemüde hier angekommen und die Begeisterung ist sofort übergeschwappt. Es belebt.“ Zudem zeigten sich die Gäste beeindruckt von Kulitzkiis virtuosem Gitarrenspiel und betonten, wie perfekt die Musiker aufeinander eingespielt waren. Bei so viel Begeisterung durfte natürlich eine Zugabe am Ende nicht fehlen und da das Publikum gar nicht aufhören wollte mit Applaudieren, kehrten Osterkorn und ihre beiden Begleiter gleich drei Mal auf die Bühne zurück, um noch ein Lied zum Besten zu geben, bevor das Konzert dann wirklich zu Ende ging.
19. Februar 2011 | Weiterlesen
Gedenkfeier für Jo Jastram in der Nikolaikirche
Zum Gedenken an den Anfang Januar verstorbenen Bildhauer Jo Jastram fand heute in der Nikolaikirche eine öffentliche Trauerfeier statt. Etwa 600 Gäste waren der Einladung der Familie gefolgt, darunter Verwandte, Freunde, Kollegen und viele Menschen, die seine Kunst schätzen. Mit einem großen Strauß weißer Lilien und Kerzenlicht war die Nikolaikirche schlicht geschmückt. Zwei große Fotos – ein Porträt Jastrams und eins von seinem Atelier – erinnerten an den Künstler und seine Arbeit. Im Vordergrund war seine Plastik „Charons Nachen“ aufgestellt. Diese war „2005 aus dem Nachdenken über die körperliche Vergänglichkeit entstanden“, erinnerte Professor Dr. Horst Klinkmann. Neben dem Mediziner kamen der Maler Ronald Paris, der Jastram-Schüler und Bildhauer Michael Mohns sowie der Schriftsteller Volker Braun als enge Freunde und Weggefährten ebenfalls zu Wort. In bewegenden Reden würdigten sie Jo Jastram als Künstler und Menschen. Musikalisch gestaltet wurde die Gedenkfeier von einer Sängerin und einem Streichquartett der Hochschule für Musik und Theater, die Werke von Vivaldi, Händel und Bach präsentierten. Jo Jastram war am 7. Januar im Alter von 82 Jahren gestorben. Im Kreise seiner Familie wurde er am 7. Februar auf seinem Grundstück in Kneese bei Bad Sülze beigesetzt. Sein Lebenswerk umfasst eine Fülle von Plastiken und Reliefs, in denen er vor allem Menschen und Tiere figürlich darstellte und mit denen er auch international Aufmerksamkeit erlangte. In vielen Orten Norddeutschlands schmückt das Werk des gebürtigen Rostockers öffentliche Plätze. So hat er zuletzt für Ribnitz-Damgarten das Bronzeensemble „Der Zirkus kommt“ geschaffen. Neben dem zentral gelegenen „Brunnen der Lebensfreude“ in Rostock gibt es in unserer Hansestadt noch viele andere Figuren und Reliefs von Jo Jastram. In der Rostocker Kunsthalle erinnert derzeit eine Gedenkausstellung im Atrium an den Bildhauer. 23 Plastiken aus der Sammlung des Rostocker Kunstmuseums sind hier zu sehen.
18. Februar 2011 | Weiterlesen
Malereien von Aristide K. Ahlin
Bereits zum sechsten Mal öffnete am Mittwochabend die Berlitz Sprachschule ihre Türen für die Kunst. Wofür Elisabeth Glöde, Leiterin der Schule, auch eine ganz einfache Erklärung parat hatte. Denn schließlich seien sie und ihre Kollegen mit ihrem Unterricht für Kommunikation zuständig. „Aber neben der Sprache gibt es ja auch noch andere Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel das Bild“, so Glöde. So kommt es also, dass man bereits in der Garderobe von einem kleinen Vogel im Ei begrüßt wird. Es handelt sich gleich um das erste Werk des afrikanischen Künstlers Aristide K. Ahlin, dem man hier begegnet. Weitere seiner Werke finden sich verstreut durch die gesamten Räumlichkeiten. Ein bunter Mix aus Farben und Formen, der seine afrikanische Wurzeln erkennen lässt. Ahlins Lebenspartnerin Susanne Lilienthal stellte bei der Eröffnungsrede den Lebensweg des Künstlers vor. Für Afrika ungewöhnlich, unterstützte ihn sein Vater schon früh mit den kostspieligen aber nötigen Materialien zum Malen. Nach seinem Studium und einer Zeichenausbildung war er in seiner Heimat erfolgreicher Künstler. Die Tatsache, dass er sich heute in Deutschland aufhält, ist den politischen Unruhen in seiner Heimat Togo zuzuschreiben. Gerardo Hernandez, ehemaliger Lehrer der Schule und ebenfalls: „Ein Kind von Mama Afrika“, wie er es sagt, ergänzte noch einen weiteren Grund für Ahlins Immigration nach Europa. Er sei auf der Suche nach der Wahrheit, nach Erleuchtung. Dabei habe er allerdings nie Afrika hinter sich gelassen, sondern immer in seinem Herzen mitgetragen. Daher seien alle Bilder auch so voll von Farben, sagt er. Recht hat er, denn nahezu alle Bilder sind unglaublich farbenfroh. Egal ob das nun ein strahlendes, helles Bunt oder ein eher dunkleres, erdiges meint. Eine weitere Gemeinsamkeit stellen die Motive der Bilder dar. Starken Einfluss hat die afrikanische Mythologie, aber auch die katholische Religion, mit der Ahlin aufgewachsen ist. So kommt es also, dass entweder Tiere oder Szenen des alltäglichen Lebens in Afrika ihren Weg auf seine Bilder gefunden haben. Besonders die Tiere würden Ahlin am Herzen liegen, weiß Susanne Lilienthal. Sie seien ein großer Teil der Mythologie und würden trotzdem nicht oft gemalt. Deshalb sei es Ahlins Anliegen, genau das zu tun. „Alle Tiere haben ihre eigene Bedeutung“, erzählt er mir. So zum Beispiel auch das schon erwähnte Küken, das aus dem Ei schlüpft. Der Titel dieses Bildes lautet „Kosmisches Ei“. Es stellt die Entstehung der Welt nach der afrikanischen Schöpfungsmythologie dar. Ebenso gibt es Bilder von Großkatzen, Bienen und Ameisen zu bestaunen. Gerade die Bilder der Insekten scheinen dabei für europäische Betrachter etwas unkonventionell. Nicht etwa wegen des Motivs, der Malgrund ist das Ungewöhnliche, denn der Künstler greift hier auf Raufasertapete zurück. Jedoch lässt sich das auch auf seine Heimat zurückführen. Während wir hier in einer Wegwerfgesellschaft lebten, nutze man in Afrika alle vorhandenen Materialien, erzählt Susanne Lilienthal. Neben den verschiedenen Malgründen variieren auch die verwendeten Farben. So finden sich nicht nur ausschließlich Öl- oder Acrylmalereien in der Ausstellung, sondern auch Aquarelle und Gouache Bilder. Auffällig ist zudem, dass der Künstler sich nicht an einen Malstil hält, sondern zwischen dem Naturnahen und dem eher Abstrakten wechselt. Außerdem sind nicht alle Motive sofort erkennbar. Einige Bilder sind in Schichten gemalt und so muss man ein zweites Mal hinschauen, um alles zu erkennen. Die Bilder von Aristide K. Ahlin sind also in mehr als einer Hinsicht sehr vielseitig. So bleiben mir zum Schluss noch die Worte von Gerardo Hernandez: „Er bringt die Wahrheit aus Afrika mit. Und diese Wahrheit soll den Menschen nahegebracht werden." Wer sich also Afrika näherbringen lassen möchte, sollte auf jeden Fall einen Blick auf Aristide K. Ahlins Bilder werfen. Da sich die Bilder in den Unterrichtsräumen der Sprachschule befinden, sollte vorher ein Termin abgesprochen werden. Das wird noch ein Jahr lang möglich sein.
17. Februar 2011 | Weiterlesen
Umweltsiegel für die Messe- und Stadthallengesellschaft
Ob Florian Silbereisen, Hexe Lillifee oder die Rostocker Handballmannschaft HC Empor – in der Stadthalle stehen die Stars aus Show und Sport im Rampenlicht. Dabei wird natürlich viel Energie verbraucht. Um den Stromverbrauch zu senken, verwendet die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft schon seit einiger Zeit Energiesparlampen. Das tut nicht nur der Umwelt gut, sondern auch dem Geldbeutel. 25,7 Megawatt und 4100 Euro können so nämlich jährlich eingespart werden. Einen ähnlichen Effekt haben auch die Müllpressen in der Stadthalle und in der HanseMesse. Vier Fünftel der Transportkosten können dadurch eingespart werden. Bei ungefähr 65 Tonnen Müll, die im Jahr anfallen, kann so der CO2-Ausstoß um 950 Kilogramm verringert werden. Mülltrennung, Recyclingpapier, Soja-Tinte für den Drucker, erdgasbetriebene Autos, eine Trinkwasseraufbereitungsanlage, Verwendung von Bio-Produkten beim Catering oder ökologischer Baustoffe bei der HanseMesse – in vielen Bereichen bemüht sich die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft um umweltbewusstes und nachhaltiges Wirtschaften. „Das grüne Engagement ist für uns schon lange selbstverständlich“, sagt ihre Geschäftsführerin Petra Burmeister. Nun wurde das Unternehmen als erstes in Mecklenburg-Vorpommern dafür mit dem „Green Globe“ ausgezeichnet. Für dieses Umweltgütesiegel der Touristik- und Veranstaltungsbranche galt es, bis zu 150 Kriterien zu erfüllen. „Die Kriterien zu erfüllen ist keine Selbstverständlichkeit. Die verschiedenen Bereiche müssen genau nachgewiesen werden“, betonte Joachim König, Präsident des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC), der das Zertifikat überreichte. Gleich beim ersten Anlauf hat die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft davon 84 Prozent geschafft. Nach anfänglicher Freude stand aber sofort die Frage im Raum, wie das noch zu steigern sei, erzählt Petra Burmeister. So habe sich das Unternehmen vorgenommen, bis zur nächsten Zertifizierung in zwei Jahren weitere fünf Prozent draufzulegen. So wolle man sich unter anderem zukünftig in der Umweltallianz MV engagieren und sie beispielsweise bei der Öffentlichkeitsarbeit auf den Messen unterstützen. Bei der Umweltallianz handelt es sich um eine freiwillige Vereinbarung zwischen Landesregierung und gut 70 Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, mit dem Ziel über die gesetzlichen Vorschriften hinaus umweltgerecht und nachhaltig zu wirtschaften. Die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft ist die bisher einzige aus ihrer Branche in diesem Netzwerk und wurde mit der Übergabe einer Urkunde durch Thorsten Permin, Referatsleiter im Umweltministerium, offiziell in dieses Netzwerk aufgenommen.
16. Februar 2011 | Weiterlesen
Long Voyage und AndA im Peter Weiss Haus
Nachdem im Januar mit Sarsaparilla die Konzertreihe „Like Water“ im Peter Weiss Haus eröffnet wurde, gab es nun am gestrigen Abend die Fortsetzung. Diesmal mit dabei: „Long Voyage“ aus Leipzig und „AndA“ aus Oldenburg. Hinter „Like Water“ verbirgt sich eine Konzertreihe für akustische und ruhige elektronische Musik, die vom Label und Künstlernetzwerk Analog Soul organisiert wird. Neben Rostock gibt es dabei auch Konzerte in Leipzig, Jena und Chemnitz, wobei sich die Bands von Stadt zu Stadt unterscheiden können. Doch zurück nach Rostock ins Peter Weiss Haus. Dort durften die Gäste auch gestern wieder auf Holzklappstühlen Platz nehmen und so entspannt der Musik lauschen. Wobei beim Auftritt der Indie-Folk Band „Long Voyage“, der eine oder andere wahrscheinlich lieber gestanden hätte, da deren Songs überwiegend im Up-Tempo Bereich zu finden waren. Doch auch so konnten die beiden Leipziger Marcus Katscher (Percussions) und Daniel Deichfuß (Akkordeon, Gitarre) gemeinsam mit ihrem kanadischen Sänger Nicolas Huart das Publikum überzeugen. „Das Schönste war, dass man den Jungs angesehen hat, dass es ihnen Spaß macht“, äußerte sich Matthias Röpke während der Umbaupause und auch Irene hatte der Auftritt gefallen: „Sehr gute Band. Ich fand es etwas schade, dass gestuhlt war.“ Anschließend war es für das Duo „AndA“ an der Zeit, die Bühne zu betreten. Zuvor hatten sie diese in die reinste Kommandozentrale verwandelt. Da tummelten sich Walkie-Talkies, eine Säge, alte Radios oder ein Telefon, das als Mikrofon verwendet wurde, neben Gitarren und allerlei anderem Equipment. Und damit kann man nun Musik machen? Ja, man kann. Zumindest können es Martin Seedorf und Lars Kämpf. Ursprünglich hatten sie mit Gitarrenpop angefangen, doch das wurde ihnen irgendwann zu langweilig und so hielten zunehmend experimentelle Ansätze Einzug in ihre Musik. Die beiden Musiker sehen ihre Auftritte auch weniger als klassische Konzerte, sondern vielmehr als Medienkunstwerke. Wobei sie betonen, dass es sich bei den Stücken trotz allem immer noch um Songs handelt. In der Praxis sieht das Ganze so aus, dass mit Hilfe von Livesampling ganz eigene Klangwelten geschaffen werden. Der mit einem Stethoskop abgehörte Herzschlag wird beispielsweise zum Beat eines Songs oder eine gerade eben noch live gespielte Gitarrenmelodie wird im nächsten Moment am Computer zerhackt und in einen Breakbeat integriert, wobei die Übergänge stets fließend sind. So richtig lässt es sich eigentlich nicht beschreiben, was da auf der Bühne vorging, man muss es live gesehen haben. Das Publikum, wie z.B. Doreen Selent, war am Ende jedenfalls begeistert: „Ich fand es total schön, innovativ und einmalig. Mehr davon!“ Mehr davon wird es am 11. März geben, wenn die Konzertreihe im Peter Weiss Haus mit „Alin Coen“ und „Miss Emily Brown“ in die dritte Runde geht. Ein Datum, das Ihr Euch ja schon einmal vormerken könnt.
16. Februar 2011 | Weiterlesen
Neues Polizeigebäude in Rostock-Dierkow
Nicht nur Kriminelle, sondern gerade auch Bürger sollen das neue Polizeigebäude in Dierkow annehmen. Das wünschte gestern Bau- und Verkehrsminister Volker Schlotmann dem Polizeirevier Dierkow und der Außenstelle des Kriminalkommissariats für ihr frisch erbautes Dienstgebäude. Das dreigeschossige Haus, das schon von Weitem durch die Farben Blau und Grau als Sitz der Polizei unverkennbar ist, mag vielleicht keine architektonische Perle sein. Aber es passe in das bauliche Umfeld, wurde das äußere Erscheinungsbild gleich von mehreren Rednern anlässlich der feierlichen Einweihung in Schutz genommen. Aber nicht nur das Gebäude, sondern auch der Standort der Dienststelle in der Theodor-Heuss-Straße ist neu. Der bisherige Standort am Heinrich-Heine-Platz, der 1938 erbaut wurde, habe zwar schon eine längere Tradition, sei aber wegen der Qualität nicht länger akzeptabel gewesen, so Thomas Laum, Leiter der Polizeidirektion Rostock. Im Jahr 2008 begannen schließlich die Planungen für ein neues Gebäude auf dem jetzigen Gelände, das zuvor längere Zeit brachgelegen hatte. Nach 15-monatiger Bauzeit wurde es schließlich fertiggestellt. Etwa 2,3 Millionen Euro investierte das Land insgesamt in den Bau der Polizeidienststelle. Weitere 29 Millionen sollen noch bis 2014 nach Rostock in die Polizeistandorte in Waldeck und in der Ulmenstraße fließen, kündigte Volker Schlotmann an. Die neue Polizeidienststelle in Dierkow „ist modern und funktional eingerichtet. Sie ist verkehrsgünstig gelegen. Sie erfüllt alle Ansprüche, die polizeilicherseits an ein Dienstgebäude zu stellen sind“, zählte Thomas Laum die Vorteile auf. Auf 620 Quadratmetern Nutzfläche sollen hier zukünftig etwa 63 Mitarbeiter des Polizeireviers Dierkow und der Außenstelle des Kriminalkommissariats tätig werden. Ihr Zuständigkeitsbereich deckt dabei einen großen Teil Rostocks östlich der Warnow ab und erstreckt sich von Brinckmansdorf im Süden bis nach Hohe Düne und Markgrafenheide im Norden. In diesem etwa 106 qkm großen Gebiet leben rund 41.000 Einwohner. Davon mehr als 23.000 in den Stadtteilen Dierkow-Neu und Toitenwinkel. „Wir als Polizei haben hier einiges zu tun. Das Einsatzgeschehen ist vielfältig und wird gerade in genannten Ballungsgebieten sicherlich auch geprägt von den sozial schwierigen und zum Teil prekären Verhältnissen“, sagte Thomas Laum. So hätten sich im Jahr 2009 im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle mehr als 3800 Straftaten und mehr als 1100 Verkehrsunfälle ereignet. Mehr als zwei Drittel dieser Straftaten konnten von den Polizeibeamten aufgeklärt werden. Zukünftig soll nun die neue Polizeidienststelle für optimale Arbeitsvoraussetzungen sorgen. Zur Einweihung führte Revierleiter Uwe Tredup die Gäste durch die Räumlichkeiten, damit sie sich von den Rahmenbedingungen vor Ort einen Eindruck verschaffen konnten. Besonders lobte er den kurzen Weg über den Flur zu seinem Kollegen Ralf Jahnke, dem Leiter der Kriminalaußenstelle. Dies würde einige Arbeitsprozesse erleichtern, so der Revierleiter. Auf besonderes Interesse bei den ersten Besuchern der Polizeidienststelle stieß der sogenannte Absetzraum. „Es ist keine Gewahrsamszelle“, betonte Uwe Tredup. Dennoch soll auch hier keiner herauskommen können. Immerhin soll es dank einer modernen Fußbodenheizung angenehm warm bleiben. Und wer dann darin sitzt und aufmerksam lauscht, wird vielleicht ein Ticken wahrnehmen können. Das kommt dann wahrscheinlich von den Uhren der Herren Minister Schlotmann und Caffier, die ihre Zeitmesser in einer Schatulle bei der Grundsteinlegung einbauen ließen. Aber so leise wird es wohl nicht werden, denn auf der Polizeidienststelle wird rund um die Uhr gearbeitet.
15. Februar 2011 | Weiterlesen
Rainald Grebe und das Orchester der Versöhnung
Ein Mann, in ein Brautkleid gehüllt, mit Schleier, betritt die Bühne. Dabei hat er handelsübliche Abflussrohre. Diese legt er ins Publikum und macht darauf Musik. Ist das Rainald Grebe? Nein, das ist erst der Anfang von einem Abend, der einen häufig ratlos zurücklässt, aber noch häufiger zum Lachen bringt. Unter dem Schleier versteckte sich nicht Grebe, sondern einer seiner Mitmusiker. Der Protagonist betrat kurz darauf die Bühne, wie für ihn üblich, mit einem Indianerkranz auf dem Kopf. Überhaupt waren die Kostüme sehr gut gelungen. DJ Smoking Joe trug einen Anzug, der an Captain Jack erinnerte, Buddy Casino an der Orgel hatte einen aufgesetzten roten Irokesen, Serge Radke am Bass sah aus wie ein indischer Schlangenbeschwörer und Martin Brauer am Schlagzeug hatte mehrere unterschiedliche Kopfbedeckungen, unter anderem einen Karton und einen Fisch. Martin Brauer wurde auch mit besonders tosendem Applaus von der fast ausverkauften Stadthalle begrüßt, ist er doch er ein Kind der Stadt. Und das wusste Grebe, der sich überraschend gut in der Region auskannte und selbst auch schon mal im Moya gespielt hat, natürlich besonders herausragend anzumerken. Weiterhin waren auf der Bühne noch Marcus Baumgart an der Gitarre und ein Streichquartett. Bis das Konzert so richtig anfing, verging erstmal eine gute halbe Stunde. So lange hat es gedauert, bis alle Musiker nach und nach die Bühne betraten, begleitet von Sprüchen und Geschichten von Grebe. Rahmenhandlung, wenn man es so nennen will, war die angebliche Burn-out-Syndrom Erkrankung von ihm, woraufhin er ein halbes Jahr nichts macht und dann noch Afrika besuchte. Von den gesammelten Eindrücken und Erfahrungen erzählte er häufig in Liedform, aber auch in kleinen Anekdoten. Der Künstler zeichnet sich durch eine sehr genaue Beobachtungsgabe aus. Das zeigte sich vor allem in dem Lied „20. Jahrhundert“. Darin werden viele Sachen aufgezählt, die für uns heute noch ganz selbstverständlich sind, beziehungsweise vor einigen Jahren waren, mit denen aber Jugendliche in zehn Jahren nichts mehr anfangen können. Auch ein Lied über das Angeln und den damit verbunden Folgen fand sich im Programm wieder. Wie ein Wirbelwind fegte Grebe während des dreistündigen Programms über die Bühne. Mal in einem alten Bürodrehstuhl, der auch als Klavierstuhl verwendet wurde und natürlich auch zu Fuß, unterstützt von kleinen Tanzeinlagen. Für eine große Tanzeinlage bedurfte es dann der Hilfe aus dem Publikum. Bei „Handtaschentanz im Haus der Kulturen der Welt“ sollten Damen (es kamen auch einige Herren) auf die Bühne kommen und dann mit Handtaschen tanzen. Das sah sehr merkwürdig, aber auch sehr lustig aus. Natürlich durften auch Klassiker im Programm nicht fehlen. So gab es als zweite Zugabe Grebes vielleicht bekanntesten Song, nämlich „Brandenburg“. Das ganze Programm wurde auch durch sehr gute Lichteffekte unterstützt und auch die Bühne, die mit den angebrachten Girlanden ein wenig an das Deck eines Kreuzfahrtschiffes erinnerte, machte Eindruck. Zum Abschluss gab es erst den Song „Landleben“, der angeblich durch den Besuch des Bauernhofs von Martin Brauer bei Wismar inspiriert wurde und als letztes Lied, sehr passend, „Doreen aus Mecklenburg“. „Dafür stehen wir, Ayurveda und Hartz 4.“ Ganz so schlimm ist es nicht, aber im Kern leider doch treffend. So gab es vor allem für dieses Lied viel Applaus und die Leute konnten zufrieden nach Hause gehen. Wer das Konzert verpasst hat, muss nicht zu enttäuscht sein. Einerseits gibt es das Programm auch als CD zu kaufen, andererseits verriet Grebe während des Konzerts schon seine weiteren Planungen bis ins Jahr 2023. Und dabei war auch ein weiterer Besuch in Rostock. Wir sind gespannt, ob der Plan so aufgeht.
13. Februar 2011 | Weiterlesen
Christoph Maria Herbst: „Ein Traum von einem Schiff“
Was hat – nach Christoph Maria Herbst – die Bildzeitung mit der deutschen Gerichtsbarkeit gemeinsam? Beide sind „unabhängig, überparteilich und der Wahrheit verpflichtet“. Und vor allem haben ihm beide in letzter Zeit das Leben etwas schwerer gemacht. Schließlich wurde gleich das Romandebüt des Schauspielers mit einer einstweiligen Verfügung belegt. Dabei geht es in „Ein Traum von einem Schiff – eine Art Roman“ doch nur um die mehr oder weniger fiktiven Erlebnisse Herbsts bei den Dreharbeiten zu einer Episode des „Traumschiffs“. Zum reinsten „Thilo Sarrazin der Belletristik“ haben sie ihn hochstilisiert, wie Herbst sich mit einem Augenzwinkern empört. Auch handele es sich bei der ganzen Angelegenheit nicht etwa um eine ausgeklügelte Marketingstrategie, wie vielleicht manche vermuten mögen, sondern schlichtweg um eine Groteske. Auf die Absatzzahlen des Buches, wenn es dann wieder erwerbbar ist, wird es sich wohl kaum negativ auswirken, schließlich dürften viele erst durch die einstweilige Verfügung neugierig auf das Buch geworden sein. Etwa 100.000 Exemplare der ungeschwärzten Auflage gingen übrigens zuvor bereits über den Ladentisch. Gestern Abend stellte der Stromberg Darsteller das umstrittene Werk nun vor ausverkauftem Haus in der Universitätsbuchhandlung Thalia vor. Da es das Buch nicht zu kaufen gab, äußerte Herbst seine Bereitschaft, grundsätzlich alles zu signieren, was gewünscht wird, Körperteile eingeschlossen. Los ging es mit dem ersten Kapitel, in dem beschrieben wird, wie der Kontakt mit Wolfgang Rademann, dem Macher der Traumschiff-Reihe, zustande kam. Herbst beschreibt Rademann darin als jung gebliebenen Charisma-Koloss, dessen Lieblingswörter „Knüller, Knaller und Kracher“ seien. Am Ende des Kapitels steht die Zusage ans Traumschiff und folgerichtig beginnt das zweite Kapitel mit den Worten „Was habe ich getan?“ Im weiteren Verlauf der Lesung geht es um den Flug nach Panama, den Ausgangsort der Reise, Albträume im Hotelzimmer und Kennenlernabende. Das Motto dabei: „Ein Käfig voller Narren und ich mitten drin. Oha, das wird ein Spaß.“ Ein Spaß war es auch, Christoph Maria Herbst zuzuhören, der mit Wortwitz und pointierter Leseweise dem Publikum zahlreiche Lacher entlockte. Entsprechend schnell verging auch die Zeit, und obwohl das Publikum noch gar keine Zeit hatte, eine Zugabe zu fordern, gab Herbst noch ein Kapitel zum Besten. „Ein paar weiße Seiten habe ich noch gefunden“, scherzte er zuvor in Anspielung auf die geschwärzte Ausgabe, aus der er vorlas. Für Stromberg Fans gab es übrigens auch gute Nachrichten, denn die Produktion der fünften Staffel steht kurz bevor. „Der Papa lässt grad wachsen“, erklärte Herbst sein Erscheinungsbild, das in Kürze wieder in Bernd Stromberg verwandelt wird. Eine Nachricht, die vom Publikum mit Applaus aufgenommen wurde. Wer nun neugierig geworden ist und das Buch noch nicht sein eigen nennt, kann ab nächster Woche eine geschwärzte Auflage erwerben. Allerdings wird der Scherz Verlag, der das Buch vertreibt, gegen die einstweilige Verfügung Einspruch einlegen, um die ungeschwärzte Version zurück in den Handel zu bringen. Es könnte sich also lohnen, noch ein wenig mit dem Kauf zu warten.
12. Februar 2011 | Weiterlesen
Ferientheater: Der kleine Hobbit (nach J. R. R. Tolkien)
Die Bühne 602 lud heute Vormittag ein, einer wunderlichen Mär zu folgen. Zu Gast im Stadthafen war das Figurentheater Winter und im Gepäck hatte es eine Inszenierung nach J. R. R. Tolkien – „Der kleine Hobbit“. Sicherlich kennen wir alle die Geschichten um den Herrn der Ringe, doch was geschah eigentlich davor? Hiervon handelte die etwa einstündige Vorstellung, die sich durch viel Handarbeit auszeichnete. Mit handgemachter Musik und bunt bemalten, etwa 70 Zentimeter großen Figuren sollte sie das Publikum in eine Welt der Fantasie entführen. Doch kommen wir erst einmal zum Anfang der wunderlichen Geschichte. Wir befinden uns in der Außenstelle des Auenlandes – in Rostocks schönem Stadthafen, genauer gesagt an der Bühne 602, dem Zuhause von Bilbo Beutlin. Er ist ein Hobbit – nicht schwer zu erkennen durch Größe und die knubbeligen Füße. Ein wenig mutig, ein wenig ängstlich. Manchmal überheblich, witzig, schüchtern oder aber auch vorschnell. Fast menschlich, oder? Doch was wäre ein Hobbit auf einer Bühne ohne Abenteuer? Vermutlich jedenfalls nicht so sehenswert. Hier kommt der große und weise Zauberer Gandalf ins Spiel. Ein Drache habe den Schatz der Zwerge gestohlen und sei mit ihm auf den einsamen Berg gezogen. Doch die einzige Öffnung zu seiner Höhle wäre so klein, dass nur ein Hobbit von Bilbos Gestalt hindurchpassen würde. Nicht ganz freiwillig (denn Rostocker seien ruhige Leute, er solle es doch einmal in Warnemünde probieren!), aber frohen Mutes, machen er und drei Zwerge sich auf den Weg durch die Nebelberge. Ziel der Aktion ist es, den Schatz zurückzugewinnen. Zum Glück „kennt Bilbo keine Angst – zumindest nicht persönlich“, denn die Wege durch die Nebelberge sind die gefährlichsten und beschwerlichsten in ganz Mittelerde. Es wimmelt an ihnen nur so von Orks und Geistern. Doch Elrond, ein guter Elb, zeigt ihnen den Weg hindurch und die vier Reisenden finden hinaus in Richtung des einsamen Berges. Wie durch einen Zufall bekommt der kleine Hobbit einen magischen Ring in die Hände. Damit gelingt es ihm schließlich, den Drachen hinaus in die Stadt zu locken und den Schatz zu befreien. Das Abenteuer ging gut aus für den kleinen Hobbit und seine Gefährten. Alle etwa zehn Puppen erhielten durch Maren und Willi Winter eine individuelle Persönlichkeit, die sich vor allem durch sprachliche Feinheiten auszeichnete. Voll auf die Darstellung konzentriert, gab es allerdings viel zu wenig Gelegenheiten während der einstündigen Vorstellung zwischen den Akteuren auf der Bühne und den Zuschauern zu interagieren. Gerade bei jungem Publikum, das wie hier überwiegend aus Kindern im Kindergartenalter bestand, hätte eine stärkere aktive Einbeziehung in das Stück vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Hier und da sorgten einige Lacher für Aufheiterung, insgesamt ließen sich aber leider nur wenige in das Abenteuer einfangen.
11. Februar 2011 | Weiterlesen
Letzte Lesung der LiteraTour Nord 2010/2011
Auch wenn noch nicht entschieden ist, wer die LiteraTour Nord 2010/2011 gewinnt – feststeht, wem eigentlich ein Ehrenpreis für den außergewöhnlichsten Titel des Jahres gebührt: Jan Faktor und seinem Roman: „Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag.“ Ein Titel, der zwar viel sagt, aber noch mehr offenlässt. Um den Roman vorzustellen und auch Fragen zu beantworten, kam Jan Faktor am Dienstag ins Peter-Weiss-Haus. Die Lesung markierte den Schlusspunkt der LiteraTour Nord. Zum ersten Mal in dieser Saison fand die Lesung nicht in der anderen buchhandlung, sondern im Peter-Weiss-Haus statt. So war es diesmal auch Katinka Friese vom Literaturhaus Rostock, welche die ungefähr 60 Gäste begrüßte und, schon fast zu einer Tradition geworden, Zeit gab, um Handys auszuschalten. Dann betrat Jan Faktor die Bühne. Die Atmosphäre bei der Lesung war nicht so familiär wie in der anderen buchhandlung, da der Abstand zum Publikum größer war, dafür wirkte die Veranstaltung erhabener. Der Autor wirkte von Anfang an zurückhaltend aber sehr symphytisch. 636 Seiten umfasst das Buch, was er aber sehr trocken kommentierte: „Es ist kein dünnes Buch, aber auch nicht richtig dick. Es ist kein überflüssiges Wort in dem Buch. Und das Manuskript sah auch dünner aus, sodass ich selbst überrascht war, wie dick das fertige Buch war.“ Als erstes Stück las der gebürtige Tscheche etwas zum Aufbau der damaligen Wohnung der Familie vor. In dem Buch erzählt Protagonist Georg rückblickend von seiner Kindheit und Jugend im Prag der Nachkriegszeit. Und auch wenn der Titel anderes vermuten lässt, ist das Buch im Kern sehr ernst und beschäftigt sich auch mit familiären Problemen und dem Aufenthalt in Konzentrationslagern. Aber natürlich bleiben auch lustige, zum Teil sehr anstößige Passagen nicht außen vor. So zum Beispiel die zweite vorgetragen Stelle, die Harnflecken in Sporthosen zum Thema hatte und mit den Worten „Die Schwanzgröße spielte in der Grundschule keine besondere Rolle“ begann. Auch im anschließenden Gespräch mit Literaturprofessor Lutz Hagestedt blieb Faktor sehr besonnen und freundlich. So verriet er, wie er auf den ersten Satz des Buches gekommen ist: „Ich saß auf der Toilette beim Pinkeln und da ist er mir plötzlich eingefallen. Danach ging es dann ganz leicht.“ Dreieinhalb Jahre hat er an dem Buch gearbeitet, die erste Idee sei aber schon 25 Jahre alt. Und endlich wurde auch die Frage geklärt, warum so ein langer Titel gewählt wurde. „Georgs Sorgen um die Vergangenheit war klar. Aber ich wollte, dass Prag mit in den Titel kommt, aber nicht zu auffällig. Daher der Hodensack als Ablenkungsexplosion.“ Ich glaube die Strategie ist aufgegangen. Nach der Lesung konnten alle Gäste, die vorher schon die anderen fünf Lesungen besucht hatten, ihren Favoriten wählen. Der Autor, der die meisten Stimmen auf sich vereint, bekommt die Publikumsstimme. Die Jury selbst hat zwölf Stimmen. Man darf also sehr gespannt sein, wer am besten ankam. Entschieden wird dies Ende Februar, die Preisvergabe ist dann im Juni.
11. Februar 2011 | Weiterlesen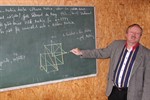
Vorauswahl zur 52. Internationalen Mathematik-Olympiade
Nachdem die 50. Internationale Mathematik-Olympiade (IMO) 2009 hier bei uns in Deutschland stattfand, ist der Austragungsort der diesjährigen Veranstaltung Amsterdam. Doch bis dorthin ist der Weg nicht nur weit, sondern auch steinig und mit Stolpersteinen gepflastert. Bundesweit wurden kleinere Mathematik-Olympiaden an den Schulen veranstaltet. Zusätzlich gab es auch die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Bundeswettbewerb. Insgesamt wurden 16 deutsche Jugendliche ermittelt, die nun zu den verschiedensten Auswahlwettbewerben geschickt wurden – etwa zu dem, der gerade auf (oder neben) dem Jugendschiff Likedeeler in Rostock stattfand. Zusätzlich zu den 16 Deutschen ist auch eine Französin mit an Bord des „Matheschiffes“ mit Kurs auf Holland. Neben vielen Klausuren wurden Mathebücher gewälzt und fleißig das abgeschrieben, was Dr. Hans-Dietrich Gronau von der Uni Rostock an die Tafel schrieb. Er ist der „Pythagoras“, der die Schüler diese Woche durch die Welt der Zahlen, Formeln und Gesetze begleitet und geleitet hat. Und Schüler, die bei der IMO teilnahmen, hätten es auch im späteren Leben oft weit gebracht, verriet er mir. So sei zum Beispiel Dr. Bodo Laß vor 20 Jahren erfolgreicher Teilnehmer des weltweiten Mathematikcontestes gewesen. Jetzt lebe er in Frankreich und unterstütze dort mit viel Engagement Projekte rund um Jugendliche. Mit einem Lächeln fügte er hinzu, dass sich selbst unsere jetzige Bundeskanzlerin Angela Merkel oft den mathematischen Hürden des Wettbewerbes stellte und dabei nicht einmal schlecht abschnitt. Am Ende der Lehrgangswoche in Rostock und den noch folgenden in Bad Homburg und im Schwarzwald werden insgesamt sechs Jugendliche ausgewählt sein, die unser Land im Sommer dieses Jahres vertreten werden. Bereits viermal unter diesen sechs Auserwählten gewesen ist Lisa Sauermann (18) aus Dresden. In der 4. Klasse nahm sie zum allerersten Mal an einem Mathematik-Wettbewerb teil, aber eigentlich interessierten sie Rätsel und Knobelaufgaben schon immer. Seit der 8. Klasse nahm sie jedes Jahr an der IMO teil – und das mit Erfolg. Bereits eine Silber- und – sage und schreibe – drei Goldmedaillen gingen bisher auf ihr Konto. Sollte sie dieses Jahr noch eine Goldmedaille bekommen, wäre sie die erfolgreichste IMO-Teilnehmerin in der seit 1959 bestehenden Geschichte. Für sie stehen bei einem solchen Wettkampf jedoch nicht nur die mathematischen Künste im Vordergrund. „Natürlich ist es schön, gut abzuschneiden. Aber genauso wichtig finde ich es, neue Menschen kennenzulernen, um sich dadurch auch persönlich weiterzuentwickeln.“ Doch neben der ganzen Mathematik bleibt sogar noch etwas Zeit übrig. Sie ist nämlich nicht nur im Bereich der Zahlen begabt, sondern auch sportlich. Somit zählen Radfahren, Wandern und Jonglieren zu einem ausgewogenen Trainingsprogramm immer mit dazu. Aber Mathe ist ihr Leben. Später möchte sie das, was sie zurzeit bereits auf regionaler Ebene tut, noch weiter ausdehnen. Ihre spezielle Förderung sei ein Geschenk und das weiß sie zu schätzen. Deshalb möchte sie ihr Wissen gerne teilen und weitergeben. Vielleicht steht sie schon bald selbst vor einer Horde Mathehungriger – wer weiß das schon. An der Uni jedenfalls ist sie auch jetzt schon gerne gesehen, wenn das Mathefieber ruft. Ich jedenfalls drücke allen heute kennengelernten Teilnehmer ganz fest die Daumen und hoffe, dass sie Deutschland gebührend vertreten werden.
9. Februar 2011 | Weiterlesen



