Neueste Nachrichten aus Rostock und Warnemünde

Judith Zander zu Gast in Rostock
Viele große Schriftsteller werden erst im späten Alter so richtig erfolgreich. Selten kommt es vor, dass schon der Debütroman für großen Wirbel sorgt. Anders bei Judith Zander. Die 30-Jährige erhielt für ihren ersten Roman „Dinge, die wir heute sagten“ den 3sat-Preis in Klagenfurt. Die Qualität des Buches scheint sich bis nach Rostock rumgesprochen zu haben, wie die Lesung am Donnerstag in der anderen buchhandlung bewies. „Platz ist in der kleinsten Hütte“, sagte Buchhändler Manfred Keiper bei seiner Begrüßung. 130 Gäste waren gekommen, um Judith Zander lesen zu hören, damit war die Veranstaltung mehr als ausverkauft. Moderiert wurde der Abend von Wolfgang Gabler, einem der Entdecker der Autorin. Schon vor Jahren hat sie Gedichte in der Rostocker Literaturzeitung Risse veröffentlicht und so ist der Lektor und Literaturagent auf sie aufmerksam geworden. „Dinge, die wir heute sagten“ spielt in der fiktiven, vorpommerischen Stadt Bresekow, die in der Nähe von Anklam liegt. Nach dem Tod der alten Frau Hanske kommt ihre Tochter mit Mann und Kind zurück in den Ort. Das bringt das Dorfleben gehörig durcheinander. Es dreht sich alles um eine Vergewaltigung und andere Leichen, welche die Dorfbewohner im Keller haben. Der Roman besitzt keine zentrale Erzählfigur, neun Personen kommen zu Wort und treiben die Geschichte hauptsächlich mit Monologen voran. Die Figuren sind aus drei Dorfgenerationen. Judith Zander gelingt es dabei sehr gut, die einzelnen Altersgruppen durch Dialekt und auch das Gesagte selbst voneinander zu unterscheiden. In der anderen buchhandlung las sie eine Passage von Romy, der jüngsten Erzählfigur, und von Hartmut, der mittleren Altersgeneration. Bei der 17-jährigen Romy stehen die Schule und Themen wie Gefühle und Freundschaft im Mittelpunkt, an Hartmut konnte man vor allem Facetten des typischen Familienlebens erkennen. Nach der Lesung gab es die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. So erfuhr man etwa, dass Judith Zander Beatles-Fan ist (die Beatles spielen auch im Buch eine wichtige Rolle) oder aber, dass der Roman an die Jugend der Autorin, die in Anklam geboren wurde und erst für das Studium Mecklenburg-Vorpommern verließ, angelehnt ist. „Es ist kein autobiografisches Buch, aber es ist auch kein nicht autobiografisches Buch“, sagte Zander. Eine andere Facette der symphytischen Schriftstellerin zeigt sich am nächsten Tag im Hörsaal der Hautklinik der Universität. Auch wenn sich die Uni mit diesem sehr heruntergekommenen Gebäude nicht von der besten Seite zeigte, waren doch viele Gäste gekommen, um der Poetikvorlesung von Judith Zander zu folgen. Am Anfang des Jahres wurde sie mit dem Sinecure Preis ausgezeichnet. Damit verbunden ist ein dreimonatiger Stipendienaufenthalt in Landsdorf auf dem Anwesen der Familie Schäfer. Diese vergeben den Preis, lassen sich aber von Universitätsprofessor Lutz Hagestedt beraten. Mit dem Preis verbunden ist diese Vorlesung und ein anschließendes Seminar in Landsdorf. Der Vortag trug den Titel „Störquellen – Die Poetik des Rauschens“ und bewies eindrucksvoll, dass Judith Zander nicht nur auf dem Gebiet der Prosa bewandert ist. Die hochwissenschaftliche Darbietung behandelte die unterschiedlichen Formen von Rauschen, die Wirkung auf den Menschen und auch die Verwendung in Kunst und Literatur. Rauschen sei dabei „die Stimme aller Weltvorgänge, universell und nicht abstellbar“, so Zander. Nach der anspruchsvollen Vorlesung ging es mit mehreren Autos nach Landsdorf, einem Ortsteil von Tribsees, wo im Gutshaus der Familie Schäfer, Judith Zanders Rostockreise ein Ende fand. Mehr Interessierte als eingeplant waren gekommen, um unter der Leitung von Lutz Hagestedt über die Texte der Autorin zu sprechen. Hausherr Gerd Schäfer betonte, dass Judith Zander der „bisher liebenswürdigste Gast war. Sie war ein feenhaftes Wesen, das durch den Park rauschte.“ Das Seminar selbst war dann eher müßig. Aus dem kurzen Romanausschnitt konnte man nicht viel über das gesamte Buch sagen. Da jedoch viele Leute noch nicht den gesamten Roman kannten, war eine umfassende Diskussion schwierig. Und auch die anschließende literaturwissenschaftliche Auseinanderpflückung des Gedichtes „blesewitzer messung“ war langwierig und für einige Anwesende durchaus unverständlich, warum ein Gedicht so tief analysiert werden muss. Trotzdem war auch das Seminar, wie schon die Lesung, von einer positiven Stimmung geprägt. Die Autorin lachte häufig, die Gäste konnten sich amüsieren und auch Lutz Hagestedt schien seinen Spaß zu haben. Zum Abschluss hatte die Familie Schäfer noch Wein, Brot und Kürbissuppe zur Stärkung vorbereitet. Schließlich mussten die meisten Gäste wieder nach Rostock. Ein gelungener Abschluss für zwei gelungene Tage.
20. November 2010 | Weiterlesen
13. Rostocker Lyriknacht im Literaturhaus
„Wenn der Wind kommt, will er zur Silberpappel. Ihre Blätter kämmt er, dass sie rauschen.“ Bläst er 100 Freunde der lyrischen Worte ins Peter Weiss Haus, dann ist die Zeit reif für die Rostocker Lyriknacht.. Zum 13. Mal veranstaltete das Literaturhaus Rostock gestern Abend die Lyriknacht und es ging dabei um nicht weniger als die Wahl des Lyrikmeisters Mecklenburg-Vorpommern 2010, nicht zu vergessen natürlich auch um die passende Trophäe in Form eines übergroßen Stiftes. Aus 53 eingereichten Beiträgen wählte die Jury 13 Teilnehmer aus, die ihre Texte live dem Publikum präsentieren durften. Wer gewonnen hat? Geduld. „Romantische oder neo-romantisch aufgeladene Bilder mit echter Erfahrung zu füllen“, das sei es, was die Jury an den Gedichten des Neubrandenburgers Eberhard Schulze beeindruckt hätte. Und zwar keineswegs nur an der eingangs schon erwähnten Silberpappel. Mangel an Lebens- und Leidenswelt? In Bildern wie dem „gespaltenen Pfirsichstein“ als „Sinnbild Deines Geschlechts“ habe dieser seinen Gegenpart gefunden, lobte Jurymitglied Steffen Dürre von der Literaturzeitschrift Weisz auf Schwarz. Belohnt wurden Schulzes emotionale Bilder mit dem 3. Platz – Glückwunsch! Ganz anders präsentierte sich Martin Badenhoop aus Rostock, der mit einer Poetologie antrat und es mit der Startnummer zwei auf den zweiten Platz und damit zum Vize-Lyrikmeister 2010 schaffte. Sich mit der ihn „unmittelbar umgebenen regionalen zeitgenössischen Lyrik und mit den Lyrikern“ auseinanderzusetzen, gefiel der Jury besonders gut. Und „dass jemand Kollegen disst“, sei ganz wunderbar. Bei seiner Anspielung („Nein, Poesie darf nie carloihde werden.“) sei es ihm jedoch nicht um die Person des ebenfalls teilnehmenden Carlo Ihde gegangen, betonte Badenhoop, sondern nur um das lyrische Schaffen, ganz im Sinne der alten Dichterstreit-Traditionen. Das dürfte auch die Jury so gesehen haben, war es für sie doch einfach ein schönes „Indiz dafür, dass es eine Dichterszene in diesem Land gibt.“ Nicht weniger interessant als seine Texte ist auch der Lebenslauf von Martin Badenhoop. Aufgewachsen in der Nähe von Kiel absolvierte der heute 27-Jähige nach seinem Hauptschulabschluss zunächst eine Maurerlehre. Vom Wunsch geprägt, Philosophie zu studieren, holte er sein Abitur nach und studiert jetzt an der Uni Rostock Philosophie und Germanistik auf Lehramt. Warum gerade Rostock? Um sich der Neuen Phänomenologie zu widmen. Nur an der Universität Rostock würde es eine Professur für phänomenologische Philosophie geben. Angefangen mit der Lyrik hat es 2007, erzählt Badenhoop. Ralf Rothmann (zufällig ebenfalls ein gelernter Maurer) sei Schuld, er habe ihn inspiriert. Nicht zu vergessen Helmut Krausser, den er sehr bewundere und von dem er alle Tagebücher gelesen hat. Und was macht man, nachdem man gerade Vize-Lyrikmeister geworden ist? Man geht ins Momo und legt Platten auf. Sei dies doch seine zweite Passion, bekennt der sympathische Funk’n’Soul -Fan. Nun aber, Trommelwirbel, zum Sieger des gestrigen Abends. Publikum und Jury waren sich einig: Der Publikums- und Lyrikmeister Mecklenburg-Vorpommern 2010 heißt Gunter Lampe. Nicht zum ersten Mal übrigens, bereits 2006 gelang dem Stralsunder Heilerzieher das Double, in der Jury- und Publikumsgunst ganz vorne zu liegen. Sein Erfolgsgeheimnis? Eine Erfolgsgarantie gibt es in der Lyrik nicht, wehrt Lampe ab, so habe er es 2007 mit seinen eingereichten Beiträgen gar nicht erst in die Endrunde geschafft. Auf den Kontakt mit dem Publikum komme es an, betont der 37-Jährige. Überraschende Wendungen einzubauen, sich zu überlegen, „was würde zünden“, das sei ihm sehr wichtig. Viel Alltag finde sich in seinen Gedichten, erläutert Lampe. Anfangs widmete er sich mehr dem Größerwerden der Kinder. Der Wunsch, als Vater „die Zeit anzuhalten“ sei dabei wohl die Motivation gewesen. Kinder spielen inzwischen keine Rolle mehr, jetzt sei es eher der Alltag, verknüpft mit heiteren Aspekten – das Ganze lyrisch getragen. „Ich musste lernen, Pausen zu machen“, beschreibt der Hobby-Fußballer seine Entwicklung. „Früher bin ich oft vom Fahrrad abgestiegen, um mir spontan Notizen zu machen.“ Inzwischen sei er beim Schreiben doch sehr viel entspannter. Als gelungene „Gratwanderung zwischen Ernsthaftigkeit und Pointe“ lobte die Jury seine Texte. Man merkt, Lampe hat sichtlich Spaß beim Spiel mit den Worten und das Publikum hat Spaß an seinem Spiel – Wortwitz, Ironie, aber nie der Pointe willen und immer das eigentliche Thema vor Augen. „Meine Entschuldigung, die simse ich Dir, wenn Du über die Straße gehst, in Dein Displayraster, in der Hoffnung es kommt, wenn Du sie liest, ein Laster.“ Mit solchen Texten gewinnt man nicht nur die Herzen des Publikums, sondern auch ganz verdient den Titel des Lyrikmeisters! Was es sonst noch gab in der 13. Lyriknacht? Zehn weitere tolle Beiträge von Meistern des Wortes, für die der Platz leider mal wieder nicht reicht. Stimmungsvolle Pianomusik von Rainer Kählig, tolle Kostproben des Jurymitglieds Jörg Schieke und – auch das sei erwähnt – ein ausgesprochen gelungenes Bühnenbild. Weiter geht es auf literarischen Pfaden bereits am nächsten Freitag, wenn ab 19:30 Uhr im Literaturhaus die druckfrische Herbst-Ausgabe der Literaturzeitschrift Risse vorgestellt wird.
20. November 2010 | Weiterlesen
Rostocker Kunstpreis 2010 für Matthias Wegehaupt
Gestern Abend wurde in der Kunsthalle der Rostocker Kunstpreis verliehen. Mit seiner fünften Auflage dürfte der Preis mittlerweile fest in der Region etabliert sein. „Er wird zunehmend bekannter“, stellte zumindest Thomas Kühl von der Provinzial-Versicherung fest und belegte diesen Eindruck mit der ansteigenden Zahl von Einträgen im Internet. Na dann wollen wir mal einen weiteren hinzufügen. Seit 2006 wird der Rostocker Kunstpreis von der Kulturstiftung Rostock und der Hansestadt Rostock jedes Jahr für eine andere Ausdrucksform der bildenden Kunst ausgelobt. In diesem Jahr bewertete die siebenköpfige Jury die Arbeiten von fünf Malern. Sie wurden zuvor aus 64 Bewerbungen ausgewählt und vor gut einem Monat in der Rostocker Kunsthalle ausgestellt. „Der Kunstpreis wendet sich an Künstler aus Rostock und der Region. Wir wollen die Kunst fördern“, sagte Professor Dr. Wolfgang Methling, Vorsitzender der Rostocker Kulturstiftung. Das sei ein berechtigtes Anliegen, verteidigte er den regionalen Kunstpreis gegenüber Vorwürfen der Provinzialität. Biene Feld, Matthias Kanter, Ute Mohns, Mike Strauch und Matthias Wegehaupt waren die fünf Glücklichen, die es in die engere Auswahl geschafft hatten. Etwa 7000 Besucher haben ihre Werke seit Ausstellungsbeginn in der Kunsthalle gesehen. „Wenn es nach den Besuchern gegangen wäre, wäre jeder Erster geworden“, fasste Dr. Uwe Neumann von der Kunsthalle den großen Zuspruch zusammen. Und Dr. Ulrich Ptak erklärte, dass es für die Jury nicht einfach gewesen wäre, sich auf einen Gewinner festzulegen. Schließlich hat sie sich dann doch für den Maler entschieden, so Jury-Mitglied Ulrich Ptak, der bisher am kontinuierlichsten gearbeitet hat: Matthias Wegehaupt. Der 1938 in Berlin geborene Maler lebt in Ückeritz auf der Insel Usedom. In seiner Arbeit ließ er sich von der ihn umgebenden Landschaft inspirieren und überzeugte die Kunstpreisjury mit seinen „Schilfbildern“. Vor allem ihre Klarheit und die Entschiedenheit des Striches sowie die Sicherheit in Farbe und Form wurden in der Laudatio von Ulrich Ptak gelobt. „Er arbeitet nicht weggeträumt, sondern aufmerksam beobachtend, mit dialektischem Grundverständnis und hellwach“, zeigte er sich nach einem Besuch des Malers an dessen Wirkungsstätte beeindruckt. „Seine Arbeiten in verschiedenen Techniken sind einfach schön. Ein wenig kann man sich doch hineinträumen“, schwärmte der Laudator. Matthias Wegehaupt selbst zeigte sich in seinen Dankesworten angesichts der Ehrung betroffen. Es war ihm ein Anliegen zu betonen, dass Kunst kein Wettkampf sei. „Es hat mich einfach erwischt. In der Kunst geht jeder seinen Weg“, würdigte er auch die Leistungen seiner Mitbewerber. Neben 10.000 Euro Preisgeld, gestiftet von der Provinzial, kann sich der Maler nun auch über eine Ausstellung seiner Werke in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns in Berlin freuen. Dass der Zuspruch für alle fünf Finalisten bei der diesjährigen Kunstpreisverleihung sehr hoch war, wurde nach der Bekanntgabe des Gewinners auch an den Reaktionen der Gäste deutlich. Helga Priester, selbst Landschaftsmalerin, zeigte sich etwas enttäuscht. Sie lehnte die Farbwahl in Matthias Wegehaupts Schilfbildern ab und bevorzugt generell eher gegenständliche Malerei. Ihr Favorit war Ute Mohns mit ihren Porträts und Blumensträußen. Auch Tim Kellner, der im letzten Jahr den Kunstpreis für seine Fotografien gewonnen hatte, hätte sich für einen anderen Maler entschieden. So zeigte er sich besonders von der fotografischen Qualität in den Malereien von Mike Strauch beeindruckt. Oder ist es doch eher eine malerische Qualität? Darüber diskutierten die beiden Künstler vor den Werken, die noch eine weitere Qualität auszeichnete: die dominierende Farbe grün. Klar, es geht um Natur. Natürliches im Gegensatz zum Synthetischen – das interessiert den Maler. Und hier wird doch der Einfluss von Bildern, die nicht aus der Malerei kommen, sondern durch die zeitgenössischen Medien vermitteln wird, thematisiert. Bilder, die an romantische Landschaften oder Blumen erinnern, werden mit Streifen und geometrischen Formen konfrontiert. Wer bisher noch nicht die Gelegenheit genutzt hat, die Arbeiten der fünf Finalisten des Rostocker Kunstpreises 2010 zu besichtigen, der kann dies noch bis zum 5. Dezember in der Kunsthalle nachholen.
20. November 2010 | Weiterlesen
Nobelpreisträger Richard R. Ernst an der Uni Rostock
Am 13. Oktober 1991 befindet sich Professor Richard R. Ernst gerade auf einem Interkontinentalflug in die USA, als man ihm die Nachricht überbringt, er habe gerade einen großen Preis gewonnen, und zwar nicht nur irgendeinen großen Preis, sondern den Nobelpreis. „Und meine Reaktion: Wow“, erinnert sich der 1933 in Winterthur in der Schweiz geborene Chemiker natürlich gerne an diesen Moment zurück. Er bezeichnet den Flug als seine dritte Schicksalsreise. Heute Nachmittag war er zu Gast im Audimax der Universität Rostock, um im Rahmen des JungChemikerForums einen Vortrag über „Die Interkulturelle Passion des Naturwissenschaftlers; Tibetische Malkunst, Pigmentanalyse und Wissensvermittlung an tibetische Mönche“ zu halten. „Es gibt nichts Schöneres, als in einer Veranstaltung aufzutreten, die ausschließlich von Studierenden organisiert wurde“, freute er sich zu Beginn über die Möglichkeit in Rostock sprechen zu dürfen. Und wie kommt man nun von der Chemie zu tibetischer Malerei? Und welches sind die ersten beiden Schicksalsreisen des Nobelpreisträgers? Doch der Reihe nach. Seinen ersten Kontakt mit der Chemie hatte Ernst, als er auf dem Speicher seines verstorbenen Onkels eine Kiste mit Chemikalien fand, die er mit in den Keller nahm und damit experimentierte. Die Leidenschaft für die Naturwissenschaft war geboren. Die logische Folge war ein Studium der Chemie an der ETH Zürich. „Es war stinklangweilig“, kommentiert er es im Nachhinein lapidar. Anschließend blieb er zunächst an der ETH, um im Bereich der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie) zu forschen. Stark vereinfacht ausgedrückt, werden dabei Magnetfelder im Molekül gemessen, wodurch das Molekül charakterisiert werden kann. Allerdings war es zu diesem Zeitpunkt sehr mühsam und sprichwörtlich nur im Schneckentempo möglich, diese Messungen durchzuführen. Die Technik war praktisch unbrauchbar, weshalb Ernst der Universität enttäuscht den Rücken kehrte. Frisch verheiratet ging er daraufhin mit seiner Frau 1963 in die USA, um im Silicon Valley bei der Firma Varian Associates zu arbeiten. Es sollte seine erste Schicksalsreise werden, denn dort gelang es ihm und seinen Kollegen, die NMR-Technik weiterzuentwickeln und schnellere Messungen zu ermöglichen. Plötzlich war es eine brauchbare Technik. „Dann war ich begeistert von der Wissenschaft und die Wissenschaft hat mich gepackt“, beschreibt er den entscheidenden Punkt in seiner Karriere als Naturwissenschaftler. 1968 sollte es dann über Asien zurück nach Europa gehen, die zweite Schicksalsreise, denn auf dieser Reise entdeckte Ernst seine Passion, die tibetische Malkunst und Kultur Zentralasiens. Besonders wichtig war es ihm, auch in seinem Vortrag zu betonen, wie wichtig eine persönliche Passion auf dem Weg zum Erfolg ist, damit man am Ende nicht einfach nur zu einem „Fachsimpel“ wird. „Auch Sie brauchen Passionen“, ermutigte er deshalb die jungen Wissenschaftler im Publikum und verwies auf eine Reihe erfolgreicher Menschen, wie Albert Einstein, der seine Geige hatte oder Helmut Schmitt, der nicht nur Kanzler war, sondern auch leidenschaftlich Piano spielte und nicht zuletzt natürlich Leonardo da Vinci, der Erfinder, Forscher und Künstler in einer Person vereinte. Für Ernst nicht allzu verwunderlich, da Wissenschaft und Kunst auf den gemeinsamen Nenner aus Neugierde und Kreativität kommen. Wieder in Zürich angekommen, machte er sich anschließend daran, die Molekularbiologie zu revolutionieren, indem es ihm und seinen Züricher Kollegen gelang, dreidimensionale Strukturen von Proteinen zu bestimmen. Seine Arbeiten stellten eine wichtige Grundlage für die spätere Entwicklung der Magnetresonanz-Tomographie dar, die aus den heutigen Krankenhäusern nicht mehr wegzudenken ist. Unterdessen vertiefte er zudem seine Kenntnisse in tibetischer Malkunst und befasste sich mit der Pigmentanalyse, um in der Lage zu sein, Gemälde instand zu halten. „Dazu muss ich wissen, wie man diese Bilder malt und wie man sie erhält“, beschreibt er seine Motivation. Mittels Ramanspektroskopie lassen sich die in den Bildern verwendeten Pigmente, wie Indigo oder Malachit, identifizieren und auch die Herkunft von Gemälden lässt sich anhand der verwendeten Pigmente lokalisieren. Dazu schießt man mit einem Laser auf das Bild, wodurch die Moleküle beginnen zu vibrieren. Diese Vibrationen werden gemessen und die Moleküle können dadurch identifiziert werden. Dem Gemälde wird dabei kein Schaden zugefügt, falls dies jemand bei der Erwähnung des Lasers befürchtet haben sollte. Darüber hinaus engagiert Ernst sich auch im Projekt Science meets Dharma, das tibetischen Mönchen naturwissenschaftliches Wissen vermitteln soll. Die Mönche lernen dabei, praktische Experimente durchzuführen, was ihnen aufgrund der theoretischen Ausrichtung ihrer Philosophie fremd ist. Der vom Dalai Lama initiierte interkulturelle Dialog hat nebenbei auch einen einfachen praktischen Nutzen, so lernen die Mönche beispielsweise, Wasser auf schädliche Verunreinigungen hin zu analysieren. Nach einer interessanten und mit viel Witz vorgetragenen Präsentation bestand im Anschluss noch die Möglichkeit, dem Nobelpreisträger bei einem Glas Sekt die eine oder andere Frage zu stellen oder sich womöglich Gedanken über die eigene Passion zu machen.
20. November 2010 | Weiterlesen
Rolf Lappert: „Auf den Inseln des letzten Lichts“
Die LiteraTour Nord führt durch Rostock und die zweite Station der Reise war Rolf Lappert. Der gebürtige Schweizer stellte am Dienstag seinen Roman „Auf den Inseln des letzten Lichts“ in der anderen buchhandlung vor. Doch bevor er lesen konnte, gab es auch für ihn die traditionelle Stadtführung von Literaturprofessor Lutz Hagestedt. Ich durfte die beiden begleiten. Der Weg führte uns zuerst ins Rathaus, einen Überblick über Rostock gewinnen. Dann folgte die Marienkirche, in der wir mithilfe der Astronomischen Uhr herausfanden, dass Rolf Lappert an einem Sonntag geboren wurde. Weiter führte der Weg zur Petrikirche, von der aus sich der Autor Rostock von oben anschauen konnte. Dann ein Mittagessen im Kartoffelhaus, ein Spaziergang am Hafen, ein Blick in die Zoologische Sammlung und der Rückweg zum Hotel. Schon bei der Führung gewann ich den Eindruck, dass Lappert ein sehr symphytischer Mensch ist, der sich jedoch jede Antwort genau überlegt. So machte er einen sehr besonnenen Eindruck, welcher sich auch auf der Lesung bestätigen sollte. Diese fand wieder in der anderen buchhandlung statt, da im Literaturhaus momentan umgebaut wird, wie Manfred Keiper, der Inhaber der Buchhandlung, berichtete. Ungefähr 100 Gäste waren gekommen, um Rolf Lappert lesen zu hören. In seinem aktuellen Roman steht das Geschwisterpaar Megan und Tobey O Flynn im Mittelpunkt. Tobey sucht seine Schwester und kommt so auf eine Insel, auf der scheinbar Primatenforschung betrieben wird. Jedoch entdeckt er mit der Zeit, dass die Insel einige Geheimnisse beherbergt. Das Buch schneidet dabei sehr viele Themenkomplexe an, den Verlust der Eltern, Vegetarismus, Drogen und andere, doch die Beziehung der Geschwister steht im Mittelpunkt. Eine Besonderheit des Romans ist sein Aufbau. Es gibt einen Prolog und einen Epilog, dazwischen wird erst Tobeys Zeit auf der Insel, dann seine Zeit in Irland und zuletzt werden noch Megans Erlebnisse dargestellt. So lösen sich anfängliche Rätsel erst gegen Ende und man bekommt einen ganz neuen Blickwinkel auf bestimmte Begebenheiten. Ansonsten war alles wie immer bei der LiteraTour Nord. Nach der einstündigen Lesung gab es ein Gespräch mit Literaturprofessor Lutz Hagestedt. Dieses Gespräch war zwar wieder sehr amüsant, jedoch wenig informativ. Hagestedt eröffnete mit der Frage, ob Lappert alleine lebt, was den Autor sichtlich überraschte: „So etwas wurde ich noch nie gefragt!“ Auch sonst war es diesmal hauptsächlich der Literaturwissenschaftler, der redete. „Ich will eigentlich gar nichts vom Autor wissen, ich bewundere ihn nur“, sagte er, um zu verdeutlichen, dass er die Moderation sehr anstrengend findet. Anschließend durfte das Publikum wieder Fragen stellen. So entlockte ein Gast dem Autor, dass er nur äußerst ungerne recherchiert. Zwar reise er viel, übertriebene Recherche vermeide er aber. „Jeder Autor sollte die Bücher schreiben, die er gern lesen würde“, sagte Lappert und sorgte so für ein gelungenes Schlusswort. Dann wurden wie immer noch zahlreiche Bücher gekauft und natürlich auch vom Autor signiert. Wie die Chancen für den Schweizer stehen, kann man jetzt noch nicht beurteilen. Vielleicht sind wir nach der nächsten Lesung etwas schlauer. Bestritten wird sie am 7. Dezember von Iris Hanika, wieder in der anderen buchhandlung.
19. November 2010 | Weiterlesen
Beatrice von Weizsäcker: Die Unvollendete
„Umfrageschock: Jeder vierte wünscht sich die Mauer zurück“, so titelte die Bild-Zeitung im März diesen Jahres. Anlass der Umfrage war der zweiteilige Sat 1 Spielfilm „Die Grenze“, der im Frühjahr ausgestrahlt wurde. Auch wenn die Umfragewerte sicherlich fragwürdig sind, so drückt sich darin doch aus, dass die innerdeutsche Einheit auch zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung von Ost und West zwar auf dem Papier, nicht aber in den Köpfen wirklich aller Bundesbürger abgeschlossen ist. Um das Thema „Deutsche Einheit“ geht es auch in Beatrice von Weizsäckers neuem Buch „Die Unvollendete“. Dieses stellte die Tochter des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am Donnerstagabend in der Universitätsbuchhandlung Weiland vor. Inhaltlich ist das Buch in die folgenden drei Teile gegliedert: Damals: Vereint! Verhöhnt? Heute: Vereint! Versöhnt? – Eine Spurensuche Morgen: Vereint! Versöhnt! Im Vorwort wird aber zunächst ein Vergleich mit den Südstaaten in den USA nach dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert angestellt. Auch über 100 Jahre später spüre man dort noch die Folgen der Abspaltung und anschließenden Wiedereingliederung in die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Kriegsende. Die Südstaatler mussten nicht nur die schmerzliche Niederlage verkraften, sondern fühlten sich auch aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche unterlegen. Bis in die 90er Jahre hinein blieb man Nordstaatlern gegenüber misstrauisch und hielt sie für arrogant. Nicht gerade ermutigende Aussichten! Im Folgenden wird deshalb der Frage nachgegangen, wie weit der Prozess der Vereinigung in Deutschland fortgeschritten ist und ob es sich tatsächlich um ein Volk handelt. Beispiele aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Sport oder Kunst werden ausführlich erläutert, so auch die Ausstellung „60 Jahre, 60 Werke“. Diese ist alles andere als ein leuchtendes Beispiel von Einheit, im Gegenteil. Die Idee dahinter war es, zum 60. Geburtstag des Grundgesetzes für jedes Jahr ein Werk eines Künstlers auszustellen. Allerdings wurde kein einziger Künstler ausgewählt, der vor 1989 in der DDR gelebt und gearbeitet hatte. Lediglich Künstler wie A. R. Penck, die lange vor dem Mauerfall in den Westen gegangen sind, wurden berücksichtigt. Die Begründung lautete, dass in einer Diktatur keine Kunst und Kultur gedeihen könne. Aber entstehen nicht gerade unter widrigen Umständen mitunter die besten Werke? Ein Schlag ins Gesicht in jedem Fall für jeden Künstler, der in der ehemaligen DDR aktiv war. Teilweise erweckte die Lesung trotz aller Notwendigkeit, den Finger auch einmal in die Wunde zu legen, dann doch den Eindruck, als ob die Autorin bewusst das Trennende sucht und es dem Verbindenden, Gemeinsamen vorzieht. Wodurch phasenweise der Eindruck entstehen konnte, dass irgendwie alles schlecht war seit der Wiedervereinigung. Positives? Fehlanzeige, von den Städtepartnerschaften wie beispielsweise zwischen Rostock und Bremen einmal abgesehen, aber die existierten ja auch vorher schon und sind nicht unbedingt ein Verdienst der Wiedervereinigung. Immerhin stellte Beatrice von Weizsäcker an das Ende ihrer Lesung ein positives, praktisches Beispiel, wie Versöhnung aussehen kann, und beruhigte damit auch etwas die Gemüter des einen oder anderen Zuhörers, die sich im Laufe des Abends zum Teil ein wenig erhitzt hatten. Dabei führte sie Uwe Holmer an, der es war, der Erich Honecker und dessen Frau in seiner eigenen Wohnung Asyl gewährte, nachdem diese durch das Ende der DDR obdachlos geworden waren. Und das, obwohl Holmer keine leichte Zeit in der DDR gehabt hatte. Dennoch war es für ihn selbstverständlich, dass er als Christ nicht beten könne „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ und dann anschließend nicht danach zu handeln. Ein ermutigendes Beispiel gelebter Versöhnung. Vielleicht ist es ja doch möglich auch in weniger als 100 Jahren vereint und versöhnt zu sein.
19. November 2010 | Weiterlesen
Zwei grüne Riesen für den Rostocker Weihnachtsmarkt
Bunte Kugeln und Lichterketten, Tannengrün und Schokoladenweihnachtsmänner – es ist nicht mehr zu übersehen: Die Weihnachtszeit rückt immer näher. Und zur Vorweihnachtszeit in unserer Hansestadt gehört natürlich der Rostocker Weihnachtsmarkt. Nächsten Donnerstag wird er wieder eröffnet. Schon heute haben zwei Stars des Weihnachtsmarktes ihren Platz eingenommen. Vor dem Kröpeliner Tor und dem Haus der Schifffahrt sollen zwei große Tannen bis kurz nach dem Weihnachtsfest die Passanten mit ihrer grünen Pracht erfreuen. Und es sind nicht irgendwelche Tannen. Es sollen die größten Weihnachtsbäume in Mecklenburg-Vorpommern sein. Sie ragen 22 und 23 Meter in die Höhe. So viel Pracht und Größe verdienen zu Recht einen Starauftritt. Ihre Ankunft am Morgen wurde demzufolge durch eine Polizeistreife eskortiert. Eine Stretchlimousine war für die beiden Stars allerdings viel zu klein. Da musste schon ein langer LKW her. Straßensperren sorgten für ausreichend Abstand. Eine kleine Pressemeute und eine Handvoll Schaulustiger schenkten ihrem ersten Weihnachtsmarktauftritt gebührende Aufmerksamkeit. Dieser war auch gleich einer von der waghalsigen Sorte, ein Drahtseilakt so zu sagen. Am Stamm nur mit einer langen Kette befestigt, wurden die Riesen, die über fünf Tonnen wiegen, von einem Kran aus der Waagerechten in die Senkrechte gehievt. Aber damit nicht genug der Spannung. Die größte Herausforderung bestand darin, den Stamm in das Loch zu bekommen. Vier starke Männer mussten mit anpacken. Augenmaß und Präzision waren hier gefragt. Doch der erste Versuch missglückte. Der Stamm war zu dick. Da musste die Motorsäge her. Unter ihrem Gekreisch verstummte das Ächzen der Bäume, denen nach und nach kleine Holzstücke abgesägt wurden. Schließlich passte alles. Die Bäume standen und wurden mit Seilen abgesichert. Fehlt nur noch das passende Outfit zum großen Auftritt auf einem Weihnachtsmarkt. Für Weihnachtsbäume sind das natürlich die Lichterketten. Die werden in den nächsten beiden Tagen angebracht. Damit erstrahlen die beiden selbst an grauen Wintertagen und bringen weihnachtliche Stimmung in die Stadt. Bis zum 28. Dezember – dann ist auch für sie der Weihnachtstraum zu Ende. Nein, sie werden nicht den Elefanten als Mahlzeit überlassen. Zu groß ist die Gefahr, dass die exotischen Rüsseltiere eine versehentlich hängen gebliebene Lichterkette verschlingen könnten. Stattdessen werden die Nadelbäume zu Kaminholz zerhackt und flammen ein letztes Mal auf, um für behagliche Gemütlichkeit zu sorgen. Das Schicksal der beiden grünen Riesen ist also besiegelt. Dabei hatten sie für Weihnachtsbaumverhältnisse ein eher ungewöhnliches Vorleben. Sie kommen nämlich nicht aus einem idyllischen Wald, sondern sind in der Stadt groß geworden. Bis vor Kurzem standen sie noch in der Kufsteiner Straße in Reutershagen, wo sie den Bewohnern aber zu groß geworden waren. Sie und jeder andere Weihnachtsmarktbesucher können nun in den nächsten Wochen bestaunen, was aus ihnen geworden ist.
19. November 2010 | Weiterlesen
Kultur in der Universitätsstadt Rostock
Was ist eigentlich Kultur? Es gibt keine allgemeingültige Definition für den Begriff. Die UNESCO bezeichnet Kultur als Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Der niederländische Wissenschaftler Fons Trompenaars definiert: „Ein Fisch spürt erst dann, dass er Wasser zum Leben braucht, wenn er nicht mehr darin schwimmt. Unsere Kultur ist für uns wie das Wasser für den Fisch. Wir leben und atmen durch sie.“ In einem sind sich die unterschiedlichen Definitionen von Kultur jedoch einig – darin, dass es sich um ein wichtiges Gut der Menschheit handelt. Und auch wenn Rostock manchmal auf dem Gebiet ein wenig hinterherhinkt, gibt es doch zweimal im Jahr Kultur konzentriert – in Form der Kulturwoche. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass es sich bei der Kulturwoche um eine Aktion der Studierendenschaft der Universität handelt. Darum hier auch erst noch mal ein kurzer Exkurs in Sachen studentische Selbstverwaltung. Einmal im Jahr wählen die 15000 StudentInnen der Hochschule ihre Vertretung, den StudentInnenrat, kurz StuRa, sozusagen das Parlament. Der StuRa wählt dann den Allgemeinen Studierendenausschuss, kurz AStA. Der AStA stellt die Regierung der StudentInnen dar. Er ist in einzelne Referate aufgeteilt, die sich mit den Belangen der Studenten beschäftigen. Nachdem der neue AStA gewählt wurde, stand der StuRa auf seinen letzten Sitzungen vor einer ersten großen Herausforderung – dem Haushalt für das nächste Jahr. Dabei merkte man aber auch schon auf der Sitzung, dass die Studierendenschaft ihre Außenwirkung verbessern will. Die Sitzung wurde öffentlich abgehalten und dies soll auch weiterhin passieren, um eine zeitnahe Berichterstattung zu ermöglichen. Die missliche Lage in der Haushaltsdebatte war, dass ein komplett ausgeglichener Haushalt hermusste. Mit den bisherigen fünf Euro, die jeder Studierende mit dem Semesterbeitrag zahlt, war dies nicht möglich. Daher wurde beschlossen, den Beitrag auf sieben Euro pro Semester zu erhöhen. Diese Entscheidung wurde jedoch nicht auf die leichte Schulter genommen. Zwei Sitzungen waren nötig, eine bis 3:50 Uhr nachts und eine bis 2:30 Uhr, um alle Bedenken und Unklarheiten soweit aus dem Weg zu räumen, dass Haushalt und Beitragsordnung beschlossen werden konnten. Ohne die Erhöhung bestand die Gefahr einer Haushaltssperre, durch welche die Studierendenvertretung fast handlungsunfähig gemacht worden wäre. Nur so können auch weiterhin studentische Medien und Interessen vertreten, soziale Belange diskutiert und Kultur gefördert werden. Für Letzteres ist im AStA in dieser Wahlperiode Kulturreferentin Caroline Heinzel zuständig. Die 21-Jährige studiert im fünften Semester Politikwissenschaft und Anglistik. Die Studentin findet das kulturelle Angebot der Stadt ausbaufähig. „Es wiederholt sich einfach zu oft oder ist für Studenten zu teuer.“ Darum will sie auch in ihrem Referat weiterhin Möglichkeiten schaffen, dass Studenten am kulturellen Leben der Stadt teilnehmen und es auch selbst aktiv mitgestalten. So ist zum Beispiel schon ein studentischer Kunst- und Handwerksmarkt geplant und auch Ausstellungen würde Caroline gern organisieren. Im Zentrum des kulturellen Lebens sieht sie aber auch weiterhin die Kulturwoche. Dabei ist diese natürlich auch ans Landeshochschulgesetz gebunden. Oberste Regel ist: „Von Studierenden, für Studierende und mit Studierenden.“ Und doch ist es wichtig, nicht nur Studenten als Publikum zu gewinnen. „Für mich ist die Kulturwoche eine Brücke zur Stadt. Die Studierendenschaft steht zwar im Zentrum, sie soll sich aber nicht abschotten“, sagt die Referentin. So seien auch externe Künstler wichtig, um den StudentInnen Möglichkeiten für Inspiration und Austausch zu geben. Außerdem wird durch die Kulturwoche auch die Außenwahrnehmung der Studierenden in Rostock gestärkt. Das bestätigt auch Erfinder und Organisator Daniel Karstädt. Der Student, der jedoch hauptsächlich eine kleine Veranstaltungsfirma leitet, war auch in diesem Jahr wieder sehr zufrieden mit den zwei Kulturwochen. Jetzt im Herbst waren wieder 12 von 15 Projekten ausverkauft. „Wir haben eine Auslastung von 90 Prozent und es gab nur positiven Rücklauf in diesem Jahr. Das Konzept ist voll aufgegangen“, sagt Karstädt. Die Kulturwoche war 1999 sein Einstiegsprojekt als Kulturreferent des AStAs. Die längste Tradition hat dabei die Südamerikanische Nacht, die mit 1500 Besuchern im Jahr 2001 auch noch den Besucherrekord hält. Das größte Gastspiel in der Hansestadt war im Jahr 2006 Kurt Krömer. 1200 Leute sahen seinen Auftritt in der Scandlines Arena. Doch gab es natürlich auch Rückschläge. „Mein größter Misserfolg war die Wahl zum Mr. und Ms. Rostock. Zwar wollten wir hauptsächlich universitäre Kategorien abfragen, jedoch wurde schon während der Planung der Widerstand zu groß, das Projekt sei zu sexistisch.“ Doch wie geht es jetzt weiter mit der Kulturwoche? Durch den geretteten Haushalt wird es auch weiterhin Gelder für die Kulturwoche geben. Diese wird öffentlich ausgeschrieben und dann wird vom StuRa entschieden, wer sie organisieren wird. Und natürlich wird sich auch Daniel Karstädt wieder bewerben und durch seine große Erfahrung hat er gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Danach muss jedoch noch das genaue Konzept vorgelegt werden – alles Schritte, die viel Zeit kosten. Auch mangelt es laut Karstädt an der Unterstützung durch die Universitätsleitung und die Stadt. Zwar bezahlt die Universität 500 Euro für Werbung, doch gibt es kaum logistische Unterstützung. Von der Stadt gibt es gar keine Mittel und das, obwohl die Kulturwoche eins der kulturellen Aushängeschilder von Rostock ist. Egal, welche Definition für Kultur man anwendet, eins steht fest. Durch die Kulturwoche und die Kulturveranstaltungen der Studierendenschaft generell wurde der Kulturbegriff entstaubt. Und, um es mit den Worten von Daniel Karstädt zu sagen, muss man: „Einfach mal etwas Neues wagen und etwas Neues machen, um etwas Neues zu erleben!“
18. November 2010 | Weiterlesen
Bürgerforum zum Strukturkonzept für Warnemünde
Fast sechs Wochen sind es noch bis Heiligabend, für die Warnemünder hatte Rostocks Oberbürgermeister aber schon gestern die Geschenke im Gepäck. Die Straßen werden saniert, eine neue Sporthalle entsteht und die Mittelmole wird bebaut. Warum das alles? „Weil wir es uns finanziell leisten können“, erklärte Roland Methling selbstbewusst dem etwas verblüfften Publikum. Rund 200 Gäste hatten sich gestern Abend zum 1. Bürgerforum im Technologiezentrum Warnemünde (TZW) eingefunden. Thema war das „Strukturkonzept Warnemünde“, in dem eine städtebauliche Rahmenplanung für das Ostseebad bis zum Jahr 2025 erarbeitet wird. Die angespannte Situation bei den Sportanlagen schien vielen Warnemündern unter den Nägel zu brennen. Schon vor zwei Jahren hatte Methling bekundet, das Haus des Sportes und den Sportplatz am TZW verkaufen und dafür eine Sporthalle bauen zu wollen. Verständlich, dass einige Warnemünder den Worten aus der Stadtverwaltung nicht mehr viel Glauben schenken. Nun aber sollen Taten folgen. Noch in diesem Jahr wird mit dem ersten Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz in der Parkstraße begonnen, der zweite folge 2011. Im Jahr 2012 könne die Sporthalle in die Haushaltsplanung aufgenommen werden und dann kann schon 2013, so Methling, „nicht irgendeine Sporthalle, sondern eine Dreifelderhalle mit Publikumsrängen hier in Warnemünde stehen.“ Ein Platz nicht nur für den Sport, sondern auch für die Kultur und als Saison verlängernde Maßnahme schwebt dem Stadtoberhaupt vor: „Es muss eine Halle sein, in der auch mal Roger Whittaker auftreten kann.“ Nightwish oder die Rolling Stones wären ihm zwar lieber, aber „dafür wäre die Halle dann doch zu klein.“ Bevorzugter Standort? Für Methling ganz klar die Mittelmole. Das sah nicht nur Warnemündes Ortsbeiratsvorsitzender Alexander Prechtel anders. Er plädierte dafür, den Sport an einem Standort, am Ende der Parkstraße, zu konzentrieren. Dort sollte auch die Sporthalle hin, schlug Prechtel vor. „Die Fläche an der Mittelmole ist viel zu wertvoll, um dort eine Sporthalle hinzubauen.“ Wohnbebauung auf der Mittelmole? Ja, so Prechtel, „aber in ganz, ganz eingeschränktem Maße.“ Benötigt werde Wohnraum, den junge Menschen bezahlen können. „Warnemünde darf nicht so alt werden, dass, wenn Roger Whittaker kommt, die Halle voll ist.“ Auf der Mittelmole wird das kaum der Fall sein. Er erinnerte an die Kurparkbebauung, wo kein belebtes Wohnen entstanden sei: „Das wollen wir auf der Mittelmole nicht.“ Prechtel wünscht sich für die Mittelmole eher etwas ‚Maritimes‘, was die Kreuzfahrtpassagiere hier hält, damit sie ihr Geld im Ort ausgeben. Kleines Gewerbe, Tourismus, Gastronomie, vielleicht auch etwas Beherbergung sollten hier nach Meinung des Ortsbeiratsvorsitzenden ihren Platz finden. Die Einwohnerzahlen in Warnemünde sind rückläufig, stellte Barbara Gentschow vom Wirtschaftsforschungsinstitut wimes die von ihr zusammengetragenen Daten vor. Diese bilden die Grundlage für die Entwicklung des Strukturkonzeptes. Lediglich die Gruppe der über 65-Jährigen wuchs von 2006 bis 2009 um knapp 11 Prozent. Dennoch gibt es in Warnemünde derzeit keinen Leerstand. Es existiere praktisch kein Wohnungsmarkt, erläuterte Gentschow, und somit gibt es auch keine Möglichkeit für einen Zuzug. Weniger Einwohner und dennoch kein Wohnraum? Thema Ferienwohnungen und Appartments: 176 Einheiten mit 545 Betten gibt es lt. offizieller Beherbergungsstatistik im Stadtbereich Warnemünde. 683 Einheiten mit 2049 Betten sind nicht in der Statistik enthalten und die Dunkelziffer dürfte noch viel größer sein. „Die Unterwanderung des Wohnbestandes durch Ferienwohnungen“ ist ein echtes Problem, bestätigte auch der Stadtplaner Dr. Andreas Pfadt. Zusammen mit seinem Kollegen Wolfgang Oehler vom Hamburger Büro Convent entwickelt er das Strukturkonzept fürs Ostseebad. Mittels Zweckentfremdungsverordnung könnte hier Einhalt geboten werden. Umkehren lässt sich dieser Prozess jedoch kaum. Neuer Wohnraum müsse daher geschaffen werden. Wo die Wohnungen entstehen könnten? Folgende Vorschläge präsentierten die Planer: Güterbahnhof (300 – 350 Wohnungen) Diedrichshagen (ca. 125 Einfamilien-/Doppelhäuser) Hohe Düne / Tonnenhof (ca. 100 Einfamilien-/Doppelhäuser) Mittelmole (100 – 250 Wohnungen) Gartenstraße/Wiesenweg (100 – 120 Einfamilien-/Doppelhäuser) Immer noch im Gespräch sei auch der Sportplatz in Markgrafenheide, der grundsätzlich durchaus geeignet wäre. „Eine ganze Menge Holz“, so Pfadt, „das wird noch 10, 15 Jahre dauern, bis das realisiert wird“, schließlich müsse der Wohnungsmarkt 500 bis 1000 zusätzliche Wohneinheiten auch erstmal aufnehmen. Ganz so einfach dürfte dies auch nicht werden, protestierten Kleingarten- und Garagenverein doch schon mal vorsorglich gegen die noch sehr vagen Pläne, auf ihren Arealen Wohnungen entstehen zu lassen. Was für Warnemünde im Beherbergungsbereich noch verträglich sei? Maximal 700 Betten, diese aber auch nur im 1- bis 3-Sterne-Bereich oder ganz ohne Klassifizierung. Mit dem geplanten Umbau des Samoa-Bades sei dies bereits ausgeschöpft. „Was ist denn mit dem zweiten Bettenhaus des Neptun-Hotels?“, lautete der Einwand von Alexander Prechtel. „Das ist 4- und 5-Sterne (wenn vielleicht auch nicht auf dem Papier). Zudem noch ein großer Klopper, den wir alle nicht wollen.“ Auch im Bereich der Verkaufsflächen sehen die Hamburger Planer nicht mehr viel Luft nach oben. Bis 2020 bestehe maximal ein Bedarf von zusätzlichen 1000 Quadratmetern. Ohne Bäderregelung sei sogar ein Rückgang der Verkaufsfläche möglich. Was aus den kleinen, oft unzweckmäßig geschnittenen Geschäften vor allem in der B-Lage wohl werde, wenn diese neuen Flächen als direkte Konkurrenz auf der Mittelmole entstehen, fragten die anwesenden Geschäftsleute. Vier bis fünf Millionen zusätzlich benötigter Umsatz kämen ja nicht einfach so. Hier prallen doch noch sehr unterschiedliche Vorstellungen aufeinander – Traditionen und maritimes Flair bewahren und sich gleichzeitig modern zu entwickeln – kein einfacher Spagat. Wer sich für weitere Details des Strukturkonzeptes interessiert oder eigene Ideen einbringen möchte, kann sich per E-Mail an das Amt für Stadtplanung wenden. Das Projekt befinde sich noch in einer sehr frühen Phase, es ist immer noch lediglich ein Diskussionspapier, betonte Ralph Müller, Leiter der Stadtplanung. Im Frühjahr soll das Konzept der Bürgerschaft vorgelegt werden. Bis dahin können sich die Einwohner noch einbringen und es werde vorher auch noch ein weiteres Bürgerforum geben, versprach Müller. Bei all den guten Vorsätzen und Projekten bleibt zu hoffen, dass die Einnahmen und Ausgaben in den kommenden Jahren trotz Altschuldenabbau tatsächlich einen Überschuss in der erhofften Höhe von 10 Millionen in der Stadtkasse lassen. Mindestens, denn gefühlt scheint jeder einzelne dieser Euros bereits dreifach verplant zu sein.
16. November 2010 | Weiterlesen
Der Club der toten Dichter zu Gast im Moya
Wer am letzten Freitag auf eine Vorführung vom „Club der toten Dichter“ mit Robin Williams gehofft hatte, wurde sicherlich enttäuscht. Denn im Moya gab es keinen Film zu sehen, sondern ein Konzert zu hören. Im Jahr 2005 wurde das Projekt von Reinhardt Repke gegründet. In wechselnder Besetzung gab es seitdem drei CDs mit den dazugehörigen Touren. Das Besondere am Club der toten Dichter ist, dass nicht irgendwelche Songs aufgeführt werden, sondern immer ein Autor zugrunde liegt. Bei der ersten Tour wurden die Gedichte von Heinrich Heine zu Liedern verarbeitet, dann folgte eine Tour mit Texten von Wilhelm Busch und zurzeit gibt es Lyrik von Rainer Maria Rilke im neuen Gewand zu hören. Dabei schreibt Bandleader Repke alle Songs selbst und auch die dazugehörigen Arrangements. Im nächsten Schritt sucht er sich die passenden Musiker zusammen und dann wird die CD aufgenommen. 17 Songs sind für die dritte Auflage herausgekommen – live werden natürlich noch ein paar Lieder mehr zum Besten gegeben. Von der Qualität und dem besonderen Flair der Darbietung wollten sich am vergangenen Freitag ungefähr 200 Gäste im Rahmen der Kulturwoche selbst überzeugen. Die aktuelle Besetzung der Band besteht aus Markus Runzheimer am Bass, Andreas „Spatz“ Sperling, den man vielleicht von der Gruppe Keimzeit kennt, an den Keyboards und Tim Lorenz von den Rainbirds am Schlagzeug. Neben Reinhardt Repke selbst ist noch Katharina Franck, ebenfalls von den Rainbirds, für den Gesang zuständig. Sie spielt auch Gitarre und Percussioninstrumente während des Auftritts. Stimme und das Gefühl, mit dem Katharina Franck performte, sorgten für Gänsehautmomente im Publikum. Repke berichtete, dass die Künstlerin bei den Aufnahmen mit einer solchen Hingabe dabei war, dass sie sich selbst in Tränen sang. Die Stücke variierten von typischen Liebesliedern, über Gedichtklassiker, wie Herbsttag, das laut einer Internetseite das bekannteste Rilkegedicht sei, bis hin zu Texten wie Opfer, die selbst Repke nach eigener Aussage nicht wirklich versteht. Aber darum geht es ihm auch nicht. „Es geht mir nicht um Erklärungen, sondern um die Wirkung“, sagt er. Die Wirkung verlor jedoch etwas an Intensität, da man zeitweise den Text kaum verstehen konnte. Gerade bei etwas beschwingteren Liedern waren die Instrumente teils sehr dominant. Aber dies ist nur eine kleine Kritik und die Standing Ovations und die beiden Zugaben am Ende des Konzertes belegen eindrucksvoll, dass es den Leuten sehr gut gefallen hat. Unter den Gästen war auch Günter Stiewe. Obwohl er sonst gar nicht so der Musikfan ist, fand er es „ganz klasse!“ Er hat sich auch gleich CD und DVD des Clubs gekauft und sich von den Musikern signieren lassen. Für ihn ist die Kulturwoche das kulturelle Highlight der Stadt Rostock. „Ich habe nur zwei Veranstaltungen ausgelassen, alle anderen habe ich mit Freuden besucht.“ Auch die Organisation und das Engagement begeistern den 63-Jährigen. „Durch die Kulturwoche kann bekommt man ein richtig gutes Bild von der Jugend.“ Wie es weitergeht mit der Kulturwoche entscheidet sich im Laufe der Woche, die Zukunft des Moyas ist jedoch schon besiegelt. Im Januar wird der Club aufgrund eines auslaufenden Mietvertrags geschlossen. Eine neue Location wird schon gesucht, konnte bisher aber noch nicht gefunden werden.
16. November 2010 | Weiterlesen
Das Theater am Ring präsentiert „Hamlet“
„Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage“ – an diese großen Dichterworte hat sich jetzt auch das Theater am Ring gewagt. Am Wochenende feiert seine Version von Shakespeares Hamlet an der Bühne 602 Premiere. Die Tragödie vom dänischen Prinzen, der den Mord seines Vaters aufklären will, ist nicht das erste Stück des berühmten englischen Dramatikers und Dichters, welches von der freien Theatergruppe inszeniert wird. In den letzten 20 Jahren, so lange gibt es das Theater am Ring schon, brachte sie bereits Shakespeares „Romeo und Julia“ und „Was ihr wollt“ auf die Bühne. Für das nächste Jahr ist die Komödie „Ein Sommernachtstraum“ geplant. Und auch der Hamlet ist nicht wirklich neu. Bereits vor einigen Jahren beschäftigte sich das Theater am Ring im „Hamletsyndrom“ mit dem klassischen Stoff und versetzte ihn in unsere Zeit. Dennoch ist das Theater am Ring keine Rostocker Shakespeare Company, denn auch andere Stücke befinden sich in seinem Repertoire, vor allem viele klassische. „Wir wollen, dass junge Leute an Klassiker herangeführt werden“, erklärt Ensemblemitglied Karsten Schuldt die Auswahl. „Als Lehrer merkt man, wie wenig Interesse da ist, sich mit Theaterstücken oder überhaupt mit Literatur auseinanderzusetzen,“ bedauert der 27-Jährige. Dass der Name der alten Theaterstücke schon etwas Staub angesetzt haben könnte, schreckt den Laiendarsteller, der auch einen Jugendtheaterclub am Volkstheater leitet, nicht ab: „Wenn man sich Klassiker vornimmt und sie vielleicht auch selbst ein wenig modernisiert, kann man viel rausholen und zeigen, wie modern das Alte sein kann.“ Die aktuelle Inszenierung des Hamlets sei eher klassisch und nah am Text. „Wir versuchen die teils düstere Stimmung von Hamlet darzustellen und trotzdem das Stück mit ein wenig Humor und Unterhaltung zu würzen,“ kündigt Karsten Schuldt an, der selbst die Rolle des Claudius‘ übernommen hat. Hamletinszenierungen gab es, seit die Tragödie 1602 erschienen ist, ja schon viele. Der ein oder andere hat das Stück vielleicht auch schon einmal auf der Bühne oder im Film gesehen. Trotzdem beansprucht auch die Rostocker 2010-Version Einzigartigkeit für sich. „Wir versuchen den klassischen Text auf unsere Art auszulegen und gerade nicht nachzumachen, was in anderen Inszenierungen schon war,“ macht Karsten Schuldt neugierig. „Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, die das Publikum mit in die Szenerie hineinzieht. Es soll verstehen, warum Hamlet so verrückt wird.“ Mehr als zwanzig Personen – Studenten, Auszubildende und junge Berufstätige – sind auf und neben der Bühne an der Inszenierung beteiligt. Mit zwei Besetzungen haben sie sich in den letzten beiden Monaten auf die Premiere von Hamlet am Wochenende vorbereitet. Jeweils am 20. und 22. November führen sie die Tragödie zum ersten Mal auf. Beide Vorstellungen beginnen um 20 Uhr an der Bühne 602. Ein weiteres Mal ist Hamlet dort am 4. Dezember zu sehen. In der Aula des Erasmusgymnasiums in Lütten Klein wird es am 3. und 10. Dezember jeweils um 19 Uhr Aufführungen geben.
16. November 2010 | Weiterlesen
Volkstheater-Geschäftsführer Kay-Uwe Nissen entlassen
In einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung wurde heute der kaufmännische Geschäftsführer der Volkstheater Rostock GmbH Kay-Uwe Nissen aus seiner Position abberufen und von Oberbürgermeister Roland Methling fristlos gekündigt. Zuvor hatte sich die Mehrheit der Mitglieder des Hauptausschusses der Bürgerschaft der entsprechenden Empfehlung des Aufsichtsrates angeschlossen. Sieben Ausschussmitglieder stimmten für die Abberufung, vier enthielten sich. Das Volkstheater steht vor einem Finanzloch in siebenstelliger Höhe, Nissen wird dafür ebenso wie für die fehlende Information des Aufsichtsrats verantwortlich gemacht. So soll bis heute kein Wirtschaftsplan vorliegen. Ob dies tatsächlich so ist und ob eine fristlose Kündigung angemessen ist, dürfte wohl ein Fall fürs Arbeitsgericht werden. „Wir werden in Zukunft ohne Herrn Nissen in diesem Bereich tätig sein“, gab Roland Methling nach der Sitzung des Hauptausschusses bekannt. „Den Kurs, den das Volkstheater Rostock seit gut zwei Jahren fährt, nämlich mit ordentlichen künstlerischen Leistungen, auch überregional in ganz Mecklenburg-Vorpommern und auf der anderen Seite der Ostsee in Gedser wahrgenommen zu werden, diesen Kurs wollen wir fortsetzen“, erklärte der Oberbürgermeister. Unterstützung im kaufmännischen Bereich soll die Volkstheater Rostock GmbH übergangsweise durch die ebenfalls städtische Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (RVV) erhalten. In der kommenden Woche sind Gespräche mit RVV-Vorstand Jochen Bruhn geplant.
15. November 2010 | Weiterlesen
Vernissage zur Kunstbörse 2010 in der HMT
Ihr mögt zeitgenössische Kunst und denkt eventuell sogar darüber nach, ein Kunstwerk zu erwerben? Dann lohnt es sich für Euch womöglich, an der mittlerweile 18. Auflage der Rostocker Kunstbörse teilzunehmen, die von der Ostsee-Zeitung und dem Kunstverein zu Rostock am 4. Dezember in der Hochschule für Musik und Theater veranstaltet wird. Da man natürlich nicht die Katze im Sack kaufen und sich vielleicht auch im Vorfeld schon einmal Gedanken darüber machen möchte, welches Werk denn nun am besten ins heimische Wohnzimmer passen würde, kann man ab sofort einen Blick auf die zum Verkauf stehenden Originale werfen. Die Ausstellung wurde am heutigen Abend im Foyer der Hochschule für Musik und Theater (HMT) offiziell eröffnet. Sie zeigt die Werke von dreizehn Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern, die an der Versteigerung teilnehmen. Bei einer solchen Vielzahl von Künstlern, ist die Palette an Kunst entsprechend breit, so dass für fast jeden etwas dabei sein sollte. Egal ob Acryl auf Leinwand, Öl auf Holz, Marmorskulpturen, Fotografien, Aquarelle oder Keramiken, eine sehr große Vielfalt an Techniken wird von den teilweise jungen sowie teilweise bereits etablierten Künstlern genutzt. „Ich finde es nach wie vor spannend zu beobachten, wie reich und vielfältig die Szene hierzulande doch ist“, kann sich Jan Peter Schröder von der Ostsee-Zeitung auch nach fünfzehn Jahren Mitarbeit an der Kunstbörse immer noch begeistern. Stolze 750 Arbeiten von 234 Künstlern wurden seit 1993 in diesem Rahmen bereits vorgestellt und versteigert. Ein Ende der Erfolgsstory ist nicht in Sicht. „Nicht zuletzt geht es der Kunstbörse auch darum, die Künstler dieses Landes bekannt zu machen“, brachte Frank Ivemeyer, der Kanzler der HMT, das Anliegen der Kunstbörse auf den Punkt. Ein berechtigtes Anliegen, denn „Künstler können eine Stadt adeln“, wie Wolfgang Friedrich, Vorsitzender des Kunstvereins zu Rostock, weiß. Einige der Künstler waren auch bei der Vernissage selbst anwesend, etwa die Maler und Grafiker Bernhard Schrock und Elisabeth Pohl. Auch der Fotograf Ulrich Rudolph weilte unter den Gästen. Eigentlich wollte der studierte Kunstwissenschaftler nach eigener Aussage nie selbst Künstler werden, umso mehr überraschte ihn die Anfrage, ob er an der Kunstbörse teilnehmen wolle. „Welcher Künstler bekommt schon solche Publicity“, freute er sich natürlich über die Möglichkeit, seine Werke einem breiten Publikum vorzustellen. Bei seinen Bildern verwendet Rudolph Motive, die den Anschein erwecken, von Menschen gestaltet oder gemalt worden zu sein. Durch die Verfremdung der Realität entsteht Spannung in seinen Arbeiten, da dem Betrachter eine Menge Interpretationsspielraum gegeben wird. Aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Arbeiten, kann an dieser Stelle unmöglich auf alle Werke eingegangen werden. Am besten macht Ihr Euch vor Ort einfach selbst ein Bild. „Was sammelt eigentlich der Bürgermeister?“ Diese Frage stellte Wolfgang Friedrich am Ende seiner Begrüßungsworte in den Raum und forderte Oberbürgermeister Roland Methling damit indirekt zum Mitbieten am 4. Dezember auf. Und wie steht es bei Euch? Was sammelt Ihr eigentlich?
15. November 2010 | Weiterlesen
Stadtbibliothek nach Renovierung wieder geöffnet
Endlich ist die Hauptstelle der Stadtbibliothek wieder geöffnet. Vier Wochen war sie geschlossen. Was sich in der Zeit getan hat, offenbart sich den Besuchern sofort nach Eintritt in das historische Giebelhaus in der Kröpeliner Straße. Ein frischer Wandanstrich und neu verlegter Teppich verleihen zumindest der unteren der drei Etagen der Bibliothek neuen Glanz. „Wir wollten, dass es warm, hell und freundlich wird“, sagte Hannelore Abromeit, Leiterin der Zentralbibliothek bei der Wiedereröffnung am Montag. Das dürfte wohl gelungen sein. Die Farbe Rosa an den Wänden strahlt Wärme aus. Die Leuchtkraft der neuen Lampen wurde fast verdoppelt und entspricht jetzt mit 500 Lux auch den Anforderungen an eine Bibliothek. Ja und auf die freundliche Wirkung haben nicht zuletzt auch die Mitarbeiter der Einrichtung maßgeblichen Einfluss. Deren gute Stimmung dürfte zukünftig jedenfalls nicht mehr all zu oft durch körperliche Verspannung beeinträchtigt sein, denn höhenverstellbare Tische sorgen für einen ergonomisch optimierten Arbeitsplatz. Mit einem einfachen Knopfdruck lässt sich die neue Verbuchungstheke im Eingangsbereich an die individuelle Körpergröße anpassen. Davon überzeugte sich auch Henry Tesch, Minister für Bildung, Kultur und Wissenschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Er war gegen Mittag zu einer kurzen Stippvisite vorbeigekommen und hatte auch gleich noch einen Fördermittelbescheid für die Rostocker Stadtbibliothek mitgebracht. 8.640 Euro stellt die Landesregierung für ein E-Learning-Projekt zur Verfügung. Ab Mitte Dezember können sich die Bibliotheksnutzer elektronische Kurse ausleihen, die sie dann am heimischen Computer mit Internetzugang selbst abrufen. Außerdem soll es für die Lerner die Möglichkeit geben, sich in den Räumlichkeiten der Bibliothek zu treffen, um sich im persönlichen Gespräch auszutauschen. „Die Verknüpfung von persönlicher Kontaktaufnahme, Bibliothek und Elektronik, darin sehen wir die Zukunft“, so der Direktor der Stadtbibliothek Manfred Heckmann. Zunächst werden verschiedene Sprachkurse und Kurse zur Datenverarbeitung angeboten. Später soll das Angebot auch mit anderen Inhalten erweitert werden. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der beruflichen Weiterbildung. Gespräche mit dem Arbeitgeberverband hätten bereits stattgefunden. „Wir würden uns freuen, wenn diese Zusatzangebote entsprechend angenommen werden“, sieht auch die Rostocker Senatorin Dr. Liane Melzer in dem E-Learning-Projekt eine Chance für die städtische Wirtschaft.
15. November 2010 | Weiterlesen
Denis Scheck: Druckfrisch in der Buchhandlung Weiland
Was man für einen gelungenen Sonntagabend benötigt? Nicht viel: einen Mann, einen Koffer voller Bücher und ein trockenes Plätzchen. Zumindest, wenn der Mann Denis Scheck heißt und – wie man es von ihm gewohnt ist – eine bunte Auswahl zeitgenössischer Literatur in seinem Reisegepäck dabei hat. Wer den Literaturredakteur und Moderator der ARD-Sendung „druckfrisch“ kennt, weiß, dass dieser auch gern mal vor dem einen oder anderen literarischen Sondermüll warnt. Und so begann Denis Scheck den Abend mit Büchern, die die Welt nicht braucht. Bücher aus dem „Doofel“-Regal, wie sie den Giftschrank in Gedenken an „Moppel-Ich“ & Co. zärtlich nennen. Der Höhepunkt des Schwachsinns ist für den Kritiker bei Werken wie Peter Hahnes „Schluss mit lustig!: Das Ende der Spaßgesellschaft“ erreicht. Nicht etwa, weil Hahne beim ZDF arbeite oder politisch woanders stehe als er selbst, sondern weil Hahne seine Gegner mit sprachkritischen Argumenten angreife. Wer das tut, dem sollten keine Sätze unterlaufen, wie „Jetzt bezahlen wir die Quittung.“ Im Deutschen bezahlen wir schließlich immer noch die Rechnung. Und nein, „Menschen flogen durch die Luft wie Vögel“ sei keine treffende Beschreibung für die Ereignisse des 11. Septembers 2001. Das Problem ist doch vielmehr, dass wir eben nicht wie Vögel fliegen können. Sachbücher, die alle nach derselben Jahrmarktsformel „Nüchtern durch mehr Saufen“ gestrickt sind, haben es ihm besonders angetan. Überhaupt könne man den Deutschen zwischen zwei Sachbuchtextdeckeln scheinbar jeden noch so großen Bären aufbinden. „Stellen Sie sich vor: Es ist Frühjahr 1945, Sie sind Eva Braun und Sie lesen gerade ‚Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest‘. – Nein, es ist nicht egal, wen Sie heiraten!“ Für Scheck nach wie vor nicht zu toppen, ist aber „The Secret“ von Rhonda Byrne. Wenn man etwas ganz fest haben oder sein möchte, muss man sich einfach nur vorstellen, dass man es schon hätte oder sei – schon würde es einem zufallen. So laute – stark vereinfacht zumindest – das Urgesetz unserer Existenz, das Byrne beschreibt. „Ich wache jeden Morgen auf und stelle mir ganz fest vor, dass ich ein ranker, schlanker Jüngling mit lockigem Haar und eng anliegenden Ohren bin – Sie sehen, es funktioniert!“ Doch nun zu den Empfehlungen des Abends oder zumindest einem ganz kleinen Teil davon. Warum Denis Scheck lieber badet als duscht? Richtig, ein Buch mit unter die Dusche zu nehmen, wäre in der Tat eine schlechte Idee. Zumindest die ersten und letzten zehn Minuten eines Tages möchte er ganz für sich haben, da möchte er etwas lesen. Was dafür am besten geeignet ist? Märchen. „Ich lese schrecklich gern Märchen“, bekennt Scheck. Als Beispiel gab er das russische Märchen „Die endlose Geschichte vom Storch und von der Rohrdommel“ zum Besten. Knappe fünf Minuten – so viel Zeit sollte wirklich jeder für Literatur übrig haben. Kann man sich doch nicht nur um Dosenpfand und Mehrwertsteuer Gedanken machen, so Scheck. „Ich muss und möchte aus meiner Haut fahren und in das Gefieder einer Rohrdommel mit Heiratssorgen.“ Das schönste Geschenk, das man sich machen kann, seien die von Nikolaus Heidelbach fantastisch illustrierten Märchensammlungen. Nach den Gebrüdern Grimm und Hans Christian Andersen hat der Illustrator nun die von Hans-Joachim Gelberg zusammengetragenen „Märchen aus aller Welt“ gestaltet. Vampirromane? Gab es gestern auch. „Die Radleys“ von Matt Haig wären auf jeden Fall einen Blick wert, so Scheck. Eine Vampirfamilie, die in Südengland lebt und ein wenig anders ist, leben sie doch abstinent, sind also die Vegetarier unter den Vampiren. Das geht gut, bis der in dieser Tradition erzogenen Tochter der Familie eines Tages eine Leiche zu Füßen liegt … „Solar“ von Ian McEwan, „Freiheit“ von Jonathan Franzen und „JR“ von William Gaddis seien an dieser Stelle erwähnt, um drei weitere Tipps im Schnelldurchlauf abzuhandeln. Wie die Welt in 100 Jahren aussieht? Eine interessante Frage. Noch interessanter, wenn diese Frage 1910 gestellt wurde und wir jetzt, 100 Jahre später, lesen können, wie unsere Vorfahren sich unsere Gegenwart vorgestellt haben. 1910 hat der Journalist Arthur Bremer in „Die Welt in 100 Jahren“ Prognosen über die Zukunft zusammengestellt – geschrieben von Experten verschiedener Bereiche. Dass Handys bereits 1928 bekannt waren, wissen wir ja, seit kürzlich eine telefonierende Zeitreisende im Charlie-Chaplin-Film „The Circus“ entdeckt wurde. Vorausgesagt wurde diese Erfindung aber mindestens schon 18 Jahre vorher und auch sonst gibt es einige erstaunliche Voraussagen – lesenswert! Wer denkt, dass ein Literaturkritiker nichts für Comics übrig hätte, hat sich getäuscht. Gleich mehrere Empfehlungen hatte Denis Scheck im Gepäck. „Blotch – der König von Paris“ lebt Mitte und Ende der dreißiger Jahre in Paris und verkörpert die Werte und Tugenden des wahren französischen Geistes. Im Dienste der fiktiven Satirezeitschrift „Fluide Glacial“ hat er Umgang mit Künstlern wie Picasso oder Dali, verkennt aber alle. Er ist Künstler oder hält sich zumindest dafür, ist aber eigentlich das „Ressentiment auf zwei Beinen“. Blotch verkörpert die miesesten Vorurteile seiner Zeit. Für Scheck eine der ganz großen Künstlersatiren, die zeigen, dass man „Künstler sein kann und dennoch ein mieses, borniertes Arschloch.“ Ralf König („Der bewegte Mann“) hat nach der schwulen Kultur ein neues Themenfeld für sich entdeckt: die Religion. Nach der Schöpfungsgeschichte („Prototyp“), Noah und der Sintflut („Archetyp“) schließt er nun in „Antityp“ seine Religionstrilogie ab – mit dem Heilgen Paulus, der gleich zu Beginn vom Pferd und auf den Kopf gefallen ist und sich nun Saulus nennt. „Es ist wahnsinnig unfair, es ist blasphemisch, es ist antichristlich und es ist das Lustigste, Unterhaltsamste und schlichtweg Klügste und Überfälligste, was man zwischen zwei Buchdeckeln nur lesen kann“, lautet das Fazit von Scheck. Bereits zum vierten Mal luden die Universitätsbuchhandlung Weiland und das Literaturhaus Rostock zu „Druckfrisch“ ein. „Sie waren im Vorverkauf so zögerlich“, freute sich Filialleiter Florian Rieger über den großen Zuspruch, „dass wir uns gar nicht getraut haben, mehr als 100 Stühle aufzustellen.“ 120 Gäste kamen gestern, vor vier Jahren waren es noch 40. Beachtliche 54 Titel umfasst die aktuelle Bücherliste von Denis Scheck. Wer den „Literaturkritiker aus Leidenschaft“ verpasst hat, findet in dieser Woche bei Weiland einen Büchertisch mit seinen Empfehlungen. Wobei man sich jedoch von niemandem einreden lassen solle, was man unbedingt zu lesen hätte. „Sie sind mündige Leser“, gab Denis Scheck den Zuhörern zum Abschluss mit auf den Weg, „vertrauen Sie auf Ihren eigenen gesunden Menschenverstand.“ Von den 90.000 Neuerscheinungen des Jahres würden dann gar nicht mehr so viele übrig bleiben.
15. November 2010 | Weiterlesen
2. Landesfachtagung „Kultur von Anfang an“
Nicht aus jedem kleinen Geiger wird einmal ein Mozart. Dennoch lohnt es sich, bei jedem Kind musisch-ästhetische Interessen zu fördern. Denn Tanzen, Musizieren, Lesen, Malen oder Filmen machen nicht nur Spaß, sondern haben auch noch einen anderen positiven Nebeneffekt: Die Beschäftigung mit den verschiedenen Kunstformen trägt auf vielfältige Weise zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Da das Kindes- und Jugendalter besonders prägend ist, sollte kulturelle Bildung in dieser Lebensphase deshalb einen hohen Stellenwert genießen. Dafür setzen sich zumindest zahlreiche Pädagogen und Künstler im Land ein. Doch „oft macht jeder nur seins“, bemängelte Dr. Klaus-Michael Körner. Angesichts finanziell schwieriger Zeiten und bevorstehender Wahlen sei es daher wichtig, die Akteure von Bildung und Kultur zusammenzubringen, um klare, abgestimmte Vorstellungen zu haben, so der Sprecher des landesweiten Netzwerkes Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (KKJB). Um dafür einen Dialog anzustoßen, hatte das Netzwerk KKJB unter dem Dach der POPkw am Samstag zur 2.Landesfachtagung „Kultur von Anfang an“ eingeladen. „Es geht uns darum, dass wir Kindern helfen, zu selbstständigen Persönlichkeiten heranzureifen“, sagte Ministerpräsident Erwin Sellering. Das sei nicht nur eine Frage der liebevollen Zuwendung für jedes Kind, sondern auch der Chancengleichheit und sozialen Gerechtigkeit und „es ist in Zeiten ökonomisierten Denkens eine Frage der ökonomischen Notwenigkeit. Wir brauchen kreative, tüchtige Menschen“, unterstrich Erwin Sellering auch die gesellschaftliche Dimension musisch-ästhetischer Erziehung. Doch nicht jedes Kind hat die gleichen Chancen an kultureller Bildung teilzuhaben. Oft entscheidet der Geldbeutel der Eltern darüber, ob sich ein Kind die Gebühren für den Musikschulunterricht, die Malfarben oder die Fahrt zur Bibliothek leisten kann. Für Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff gehört kulturelle Bildung jedoch zur Allgemeinbildung und ist damit Pflichtaufgabe des Staates. „Jedes Kind in unserem Land soll mit jeder Kunstform in Berührung kommen“, so sein ehrgeiziges Ziel. In seiner Amtszeit hatte er als Staatssekretär für Kultur in Nordrhein-Westfalen erfolgreich das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) auf den Weg gebracht. Auch in Rostock hat JeKi schon Schule gemacht. Durch großzügige Spenden können im Osten der Stadt inzwischen 120 Grundschulkinder auf einem Instrument musizieren, informierte die Rostocker Kultur- und Jugendsenatorin Dr. Liane Melzer bei einer Podiumsdiskussion der Tagung. Auch die Landessozialministerin Manuela Schwesig war zu der Tagung gekommen, um für ihre Vorschläge zur Sicherstellung der Chancengleichheit bei der kulturellen Bildung zu werben. Als Alternative zur Ankündigung der Bundesministerin Ursula von der Leyen, eine Bildungschipkarte bzw. Gutscheine einzuführen, die Kindern aus Hartz IV Familien zugutekommen sollen, setzt sie sich für einen Bildungsfonds ein. Nach Lübecker Vorbild soll damit die finanzielle Förderung über eine pädagogische Einrichtung zum Kind gelangen. In einem Forum zur kulturellen Bildung für Kinder in Kita und Grundschulen erntete sie dafür viel Zustimmung. Denn in diesem Modell sahen viele Vertreter von Kinder- und Bildungseinrichtungen einen Lösungsansatz, um auch Kooperationen beider Seiten besser zu organisieren und eine qualitativ hochwertige kulturelle Bildungsarbeit in den Alltag der Kinder einzubetten. Dem Zusammenschluss der pädagogischen und künstlerischen Kompetenzen zu einem Tandem, wie es zum Beispiel Simone Briese vom Landesverband der Jugendkunstschulen M-V, befürwortet, stehen oft neben Fragen der Finanzierung auch organisatorische Probleme im Wege. So hat der Ausbau von Ganztagsbetreuungsangeboten in der Vergangenheit dazu geführt, dass zusätzliche Angebote zur künstlerischen Freizeitgestaltung immer weiter in den Nachmittag und Abend verlegt wurden und Familien zusätzlich belastet haben. Eine enge Zusammenarbeit der Kitas und Schulen mit Künstlern und Kultureinrichtungen könnte auch hier für eine bessere räumliche und zeitliche Vereinbarkeit sorgen. „Wir nutzen das Engagement der Künstler und Pädagogen zu wenig. Viele machen das aus Berufung“, machte Simone Briese das noch nicht optimal genutzte Potenzial für die kulturelle Kinder- und Jugendbildung deutlich.
15. November 2010 | Weiterlesen
„Die lustige Witwe“ - Premiere im Volkstheater Rostock
Es ist was faul im Staate Dänemark. Äh Verzeihung, im Staate Pontevedro natürlich. Das fiktive Fürstentum steht nämlich kurz vor dem Staatsbankrott. Die einzige Rettung: die Witwe Hanna Glawari. Diese verfügt über das Vermögen des ehemaligen Hofbankiers, den sie geheiratet hatte und der dann direkt in der Hochzeitsnacht verschied. Nun ist die Witwe in Paris und auf der Suche nach einem Mann. Heiratet sie allerdings einen Pariser, dann geht das Vermögen dem Staat Pontevedro verloren, was der Baron und pontevedrinische Botschafter Mirko Zeta entsprechend verhindern möchte. Aus diesem Grund möchte er den Grafen Danilo Danilowitsch dazu bewegen Glawari zu heiraten, doch Danilo möchte auf keinen Fall den Anschein erwecken, er wäre nur hinter ihrem Geld her, schließlich ist er tatsächlich an der Witwe interessiert. Das ist in aller Kürze die Handlung der Operette „die lustige Witwe“ von Franz Lehár, die am gestrigen Abend im Großen Haus des Volkstheaters Rostock ihre Premiere feiern durfte. Regie führte dabei Mirko Bott, der Programmchef von Schmidts Tivoli und Schmidt Theater in Hamburg. Das besondere Merkmal des Stücks ist für Bott, dass es aus dem klassischen Rahmen der Operette ausbricht. Für gewöhnlich gibt es dabei ein Hauptpaar und ein lustiges Paar. In diesem Fall sind diese Grenzen aufgehoben und auch das vermeintlich lustige Paar, Valencienne und Camille de Rosillon, bekommt ein romantisches Duett, während Graf Danilowitsch zu volkstümlichen Melodien auf der Bühne erscheint. Auf diese Weise erhält auch das zweite Paar eine tragende Rolle im Stück. Dabei stehen Hanna und Danilo im Zwiespalt zwischen Stolz und Liebe und Valencienne und Camille im Zwiespalt zwischen Geld und Liebe. Und wie kam die Vorstellung nun beim Publikum an? Offensichtlich sehr gut, so sprach beispielsweise Andreas Pasternack von einer „sehr guten Samstagabend-Unterhaltung“ und betonte, dass „unglaublich viel Pfeffer“ im Stück war. „Wir sind total begeistert“ lobten auch Jürgen Drygas und Claus-Peter Rathjen die Inszenierung. Darüber hinaus hoben beide die gute musikalische Einheit zwischen Sängern, Chor und Orchester hervor. Die humorvollen Anspielungen auf aktuelle Geschehnisse wie Finanzkrise oder Abwrackprämie kamen ebenfalls gut beim Publikum an, da sie nicht aufgesetzt wirkten, sondern geschickt ins Spiel eingewoben wurden. Diese Aussagen spiegelten sich auch im Applaus und den teilweise stehenden Ovationen nach Ende der Vorstellung wieder. Besonderen Applaus erntete Nik Breidenbach, der dem einen oder anderen vielleicht aus seiner Zeit bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ein Begriff ist. Breidenbach verkörperte die Rolle des Njegus, dem Mädchen für alles in der pontevedrinischen Botschaft, und sorgte durch sein Spiel für eine besondere komödiantische Note. Zur gelungenen Premiere hat sicherlich auch beigetragen, dass die Schauspieler selbst sehr viel Spaß am Stück zu haben schienen. Ein Funke der letztlich, vor allem im temporeichen zweiten Teil, auf das Publikum übersprang. Anna Molina, die die Hanna Glawarin spielt und erstmals in einer Operette auftritt, hat jedenfalls viel Freude an ihrer Rolle und meinte bei der anschließenden Premierenfeier: „Man kann so albern sein!“ Wer sich angenehm unterhalten lassen möchte, der bekommt mit „die lustige Witwe“ ein gewitztes und temporeiches Stück mit jeder Menge schöner Melodien. Oder, um es wie Jürgen Drygas auszudrücken: „Ich würde es mir wieder anschauen“. Fotos 1 & 2: Dorit Gätjen, VTR
14. November 2010 | Weiterlesen
Hightech in der Medizin an der Universität Rostock
„Stellen wir uns vor, wir gehen zum Arzt. Er stellt ein Gerät vor uns auf, wir atmen hinein und er weiß, was uns fehlt.“ Diese Zukunftsvision beschrieb Juliane Kleeblatt in ihrem Vortrag über die Untersuchung von Substanzen im menschlichen Atem am Donnerstagnachmittag im Rahmen der Ringvorlesung „Kurs auf die Wissenschaft“, die derzeit von der Interdisziplinären Fakultät der Universität Rostock veranstaltet wird. Dabei lieferte sie einen Überblick über die Entwicklung der Atemgasanalytik und deren gegenwärtigen Stand in der Medizin. Die Idee den menschlichen Atem für diagnostische Zwecke in der Medizin zu verwenden, ist alles andere als neu. Bereits Hippokrates befasste sich vor fast 2500 Jahren mit dem Geruch des Atems seiner Patienten und stellte Verbindungen mit bestimmten Krankheiten her. Im 18. Jahrhundert war es dann Lavoisier, der Atemexperimente mit Meerschweinchen und Menschen durchführte. Als Begründer der modernen Atemgasanalytik, wie sie heute betrieben wird, gilt aber Nobelpreisträger Linus Pauling, der 1971 erstmals über 250 Substanzen im menschlichen Atemgas und Urin detektieren konnte. Beinahe 40 Jahre später wurden schon ca. 3.000 Substanzen identifiziert. Für die Forscher der Universität Rostock sind aber weniger die Hauptbestandteile des Atems wie z.B. Stickstoff, Kohlendioxid oder Sauerstoff, sondern sogenannte volatile organische Komponenten, wie Isopren oder Alkohole, von Interesse. Diese Substanzen können sowohl im menschlichen Stoffwechsel erzeugt werden, als auch aus der Umgebung in den Körper gelangen, z.B. durch Rauchen, Medikamente oder Nahrungsaufnahme. Durch die Messung dieser Substanzen hoffen die Wissenschaftler eines Tages Krankheiten diagnostizieren zu können oder beispielsweise auch Therapieverläufe zu überwachen, ohne dem Patienten Blut abnehmen zu müssen. Da es sich dabei aber nach wie vor um Grundlagenforschung handelt, ist es noch ein weiter Weg bis dahin. Aus der Medizin ist die Atemgasanalytik dennoch bereits nicht mehr wegzudenken, so gibt es beispielsweise einen Wasserstoff-Atemtest, der zur Erkennung einer Laktoseintoleranz verwendet wird oder die Kapnometrie, die einen wesentlicher Bestandteil bei der Überwachung der Patienten in der Anästhesie darstellt. Um einen gänzlich anderen Ansatz ging es in dem Vortrag von Maxi Höntsch, die sich dem Thema „Zellen unter Beschuss – Physikalisches Plasma in der Zellbiologie“ widmete. Für alle, denen der Begriff Plasma bestenfalls aus Science-Fiction Filmen bekannt ist, hier eine kurze Erklärung: Ein Plasma ist in der Physik im Wesentlichen ein elektrisch geladenes Gas. Da dieses Gas an sich nicht stabil ist, muss ständig Energie zugeführt werden, um das Plasma aufrechtzuerhalten. Verwendung findet es bislang vor allem in der Metallindustrie. Dort wird es zur Bearbeitung von Oberflächen eingesetzt. In der Medizin wird Plasma beispielsweise zum Stillen von Blutungen oder zum Abtragen von Weichgewebe verwendet. Das Problem an der Sache: Man weiß nicht, wie das Plasma eigentlich mit dem Gewebe interagiert. Dies herauszufinden, ist die Motivation hinter Höntschs Arbeit. Erste Ergebnisse deuten auf potentielle Einsatzmöglichkeiten in der Krebszellforschung hin, denn Brustkrebszellen, die für 30 Sekunden mit Plasma behandelt wurden, konnten anschließend nicht mehr an ihr Substrat anbinden und zeigten eine deutlich verringerte Vitalität im Vergleich zu unbehandelten Zellen. Natürlich sind solche Laborergebnisse nicht mit einer Anwendung am menschlichen Körper zu vergleichen, eine vielversprechende Arbeit ist es dennoch. Im dritten und letzten Vortrag von Stefanie Wenda ging es schließlich um das Zusammenspiel von „Licht und Leben – wenn Laser auf Enzyme treffen“. Die Arbeit soll dazu dienen, diesen Prozess besser zu verstehen und dadurch das große Potenzial von Enzymen besser nutzbar zu machen. Da Enzyme biochemische Reaktionen katalysieren, können sie eingesetzt werden, um Produkte zu bilden, ohne das große Mengen an Nebenprodukten entstehen. Außerdem arbeiten Enzyme unter sehr viel milderen Bedingungen als typische chemische Katalysatoren. Damit das Ganze aber genutzt werden kann, ist es unabdingbar, die Funktionsweise der Enzymkatalyse lückenlos zu verstehen. Dazu benötigt man ein Trägersignal, das über den Prozess hinweg zurückverfolgt werden kann. Licht kann ein solches Trägersignal sein. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass drei sehr unterschiedliche Themen vorgestellt wurden, bei denen der interdisziplinäre Ansatz deutlich zum Vorschein kam. In zwei Wochen, am Donnerstag, dem 25. November, wird es dann Teil vier der Ringvorlesung geben, bei dem es um „Ambient Assisted Living“ gehen wird. Am kommenden Freitag (19.11.) um 16:00 Uhr wird darüber hinaus der Nobelpreisträger Richard E. Ernst zu Gast in Rostock sein und einen Vortrag über „die interkulturelle Passion des Naturwissenschaftlers; Tibetische Malkunst, Pigmentanalyse und Wissensvermittlung an tibetische Mönche“ halten.
13. November 2010 | Weiterlesen
Karneval am 11.11.2010 im Rostocker Rathaus
Pünktlich um 11:11 Uhr zogen heute am 11.11. die Narren in das Rostocker Rathaus ein. Angeführt wurden sie von Pierre I und Uljana I, dem Prinzenpaar des Rostocker Karneval Clubs. Das Gefolge bestand aus ihrer Prinzen- und Funkengarde und Mitgliedern der drei Vereine „Rostocker Carneval Club Warnow“, dem „Markgrafenheider Karneval-Club“ und dem „Rostocker Karneval Club“. Bereitwillig händigte Oberbürgermeister Roland Methling symbolisch den Rathaus-Schlüssel aus und stieß mit ihnen zur Feier des Tages mit einem Glas Sekt an. Anders als im letzten Jahr konnte auch wieder ganz traditionell ein Fass Rostocker Bockbier angestochen werden. Dafür fehlte allerdings die Karnevalskappe auf dem Kopf des Bürgermeisters. Für Begeisterung sorgten die Tanzdarbietungen der Prinzen- und Funkengarde des Rostocker Karneval Clubs. Mit einer sportlich ambitionierten Choreografie und strahlendem Auftreten hoben sie im Rathaus merklich die Stimmung. Neben beeindruckenden Formationstänzen legte auch die fünfjährige Josefine als Nachwuchstanzmariechen ein gekonntes Solo aufs Parkett. Mit dieser kleinen Zeremonie übernahmen die Narren das Regiment und die Karnevalssaison in Rostock war eröffnet. So richtig geht die fünfte Jahreszeit bekanntlich aber erst im neuen Jahr los, wenn der Trauermonat November und die besinnliche Adventszeit vorbei sind. Aber schon heute brachten die bunt gekleideten Narren mit Musik und Tanz Frohsinn und gute Laune ins Rathaus. Auch einigen Passanten zauberten sie ein Lächeln auf die Lippen, als sie auf der Kröpeliner Straße in Richtung Neuer Markt zogen. Auch wenn Rostock nicht gerade als Karnevalhochburg bezeichnet werden kann, so gibt es hier dennoch zahlreiche schunkelsüchtige Freunde des ritualisierten Frohsinns, die sich am Verkleiden und an den Büttenreden erfreuen.
11. November 2010 | Weiterlesen
Handwerkskammer kürt den TOP Azubi 2010
Dass Handwerk goldenen Boden hat, ist schon länger bekannt. Jedoch scheint das Interesse an handwerklichen Berufen immer mehr nachzulassen. Da ist es um so erfreulicher, dass heute junge Leute ausgezeichnet wurden, die mit viel Engagement bei ihrer Ausbildung in einem solchen Beruf dabei sind. Für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung im Gebäude der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern sorgte die Gruppe Northern Colour Trio. Die drei Studenten von der HMT Rostock konnten mit entspannten Klängen auf Bass, Keyboard und Saxofon punkten. Begrüßt wurden die anwesenden Gäste aus Handwerk und Politik, und natürlich die teilnehmenden Azubis, von Volker Brockmann, dem Ehrenpräsidenten der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. Er stellte heraus, dass die 33 Bewerber auf den Titel TOP Azubi 2010 ein hohes Allgemeinwissen, Flexibilität und Mobilität besitzen und sicher nicht zur Null-Bock-Generation gehören. Das gemeinsame Ziel der beiden Handwerkskammern, die den Preis seit 2007 abwechselnd vergeben, ist es, junge Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu halten. In seinem Grußwort betonte Jürgen Seidel, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, noch einmal, wie wichtig vor allem auch die Persönlichkeit für einen Menschen ist. Um so erfreuter zeigte er sich darüber, dass im Wettbewerb gerade auch der Charakter eine Rolle für die Entscheidung der Jury spielte. „Aktuell gibt es in den 150 Ausbildungsberufen im Handwerk 975 unbesetzte Stellen und 225 unversorgte Bewerber“, sagte Seidel. Trotzdem, so der Minister, ist es wichtig, sich zu engagieren, um einen Platz zu bekommen. Abschließend gab es natürlich auch wieder die typischen Trostformeln für alle Teilnehmer, die nicht unter die Top 3 kamen: „Dieser Wettbewerb hat keine Verlierer, jeder von ihnen gewinnt an Selbstbewusstsein.“ Aus den 33 Bewerbern wurden 16 Finalisten ausgewählt, die sich im Oktober in unterschiedlichen Tests beweisen mussten. So galt es, ein Mecklenburg-Vorpommern-Quiz und ein Rollenspiel zur Konfliktbewältigung zu bestehen, außerdem musste eine Eigendarstellung vorgetragen werden. Zu gewinnen gab es nicht nur Urkunden, sondern für die ersten drei Plätze auch Pokale und einen Geldscheck, der von der Raiffeisenbank Güstrow gesponsort wurde. Dann wurde es spannend. Zwei dritte Plätze wurden verkündet und von Jürgen Seidel, Volker Brockmann und Dieter Heidenreich, Bankdirektor der VR-Bank Rostock, verliehen. Raumausstatter Christopher Giehle und Augenoptikerin Patrizia Hintz teilen sich den Bronzerang und die 500 Euro. Der zweite Platz ging an Lisa Brech aus Waren, die im dritten Lehrjahr eine Ausbildung zur Tischlerin macht. Sie bekommt 750 Euro. Und TOP Azubi 2010 ist Vera Pauline Kerwitz. Die 21-Jährige aus Rostock absolviert seit dem 1. September 2008 eine Ausbildung zur Maßschneiderin bei Schneidermeisterin Marika Gurske in der Waldemarstraße. Über den mit 1000 Euro dotierten Preis freut sich die junge Frau, die auch Kleider ihrer eigenen Kollektion trug, sehr. „Das wird für die Gesellenprüfung draufgehen.“ Vera hat schon vor der Ausbildung geschneidert, so hat sie sich zum Beispiel ihr Abiballkleid selbst genäht. Doch auch bei ihr wird es leider nicht funktionieren, die Jugend im Land zu halten. Sie will nach ihrem Abschluss im August ein Studium in Flensburg beginnen. Dort möchte sie gern Textil und Mode auf Lehramt studieren. Bleibt zu hoffen, dass ihre Pläne in Erfüllung gehen. Aber als TOP Azubi 2010 sollte sie ja gute Chancen haben. Ich drücke ihr jedenfalls die Daumen.
11. November 2010 | Weiterlesen
Zusammenarbeit der Unis in Rostock und Alabama
Der Pressetermin am Dienstag in der Universität Rostock war schon etwas ganz Besonderes. Im kleinen Rahmen, nur drei Vertreter der Presse waren erschienen, stellten Pressesprecher Ulrich Vetter und Rektor Wolfgang Schareck die Zusammenarbeit zwischen der University of Alabama in Huntsville (UAH) und der Uni Rostock vor. Dabei wurden sogar persönliche Fotos des Besuchs des Rektors in Huntsville gezeigt. Seit einem knappen halben Jahr bestehen die Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Hochschulen. Die UAH ist die 50. Universität weltweit, die mit der Uni Rostock kooperiert. Vom 5. bis zum 8. Juni besuchte der Rektor aus Huntsville, Prof. Dr. David B. Williams, Rostock, vom 24. bis zum 28. Oktober flog Schareck zum Gegenbesuch nach Amerika. Dabei konnte schon ein sehr präziser Plan aufgestellt werden, in welchen sechs Bereichen Rostock und Huntsville zukünftig zusammenarbeiten werden. Geplant sind gemeinsame Vorhaben in den Bereichen: Astrophysik und Optik Systemengineering: Durch die Nähe und die enge Zusammenarbeit mit der NASA hat Huntsville hier einige sehr interessante Projekte geplant, die mit den Rostocker Fakultäten für Maschinenbau, Informatik, Schiffstechnik und Elektrotechnik bearbeitet werden können. Satellitengestützte Sicherheit: Hier ist vor allem geplant, die Überwachung des Ostseeraums zu verbessern. Die Zusammenarbeit erstreckt sich nicht nur zwischen den Universitäten, auch das Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik Kühlungsborn und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sind beteiligt. Präventivmedizin: Dabei geht es um das sogenannte Nurseing, was den Stress in der Kranken- und Intensivpflege reduzieren soll. Ein gemeinsames Projekt ist schon angelaufen. Zusammenarbeit in der Studienrichtung HighTech Entrepreneurship Aufarbeitung von Aufzeichnungen der Wissenschaftler und Raketentechniker in Peenemünde während des Nationalsozialismus Eine weitere Verbindung beider Hochschulen ist die Person Wernher von Braun. Der Wissenschaftler forschte in der NS-Zeit in Peenemünde an Raketentechnik und ging dann nach 1945 nach Amerika. Dort arbeitete er für die NASA und war maßgeblich an der ersten Mondmission beteiligt. Auch eine kulturelle Note hat die Zusammenarbeit von UAH und Rostock. So ist geplant, im Jahr 2012 ein gemeinsames Friedenskonzert in Peenemünde zu organisieren. Die meisten gemeinsamen Vorhaben sind bisher nur Ideen, doch zeigt sich der Rektor optimistisch, dass diese auch weiter verfolgt werden. „Wir haben die Türen aufgemacht, jetzt müssen andere sie durchschreiten“, sagte er. Im Anschluss zeigte er noch einige Fotos seiner Reise. So wurde eine Vorlesung, die er auf Wunsch des Rektors dort gehalten hatte, wegen einer Tornadowarnung unterbrochen. Das Foto 3 wurde uns freundlicherweise von der Universität Rostock zur Verfügung gestellt.
11. November 2010 | Weiterlesen
13. StudentenFilmFest „Goldener Toaster“ 2010
„Männer leeren Drinks grundsätzlich in einem Zug.“ In einem fahrenden, versteht sich. Mit solch satirisch in Szene gesetzten Filmweisheiten wusste einer der Beiträge beim gestrigen 13. StudentenFilmFest „Goldener Toaster“ zu beeindrucken. Um welchen Film es sich dabei handelt? Das wird natürlich nicht verraten, noch nicht. Um es vorwegzunehmen: Auch diese Veranstaltung der Kulturwoche war wieder ausgesprochen gut besucht. Aufgrund des großen Zuspruchs gab es gestern Abend gleich zwei Vorstellungen im Kinosaal des Lichtspieltheaters Wundervoll (Li. Wu.) – mit über 200 Besuchern waren beide restlos ausverkauft. Aus mehr als 20 eingereichten Filmen hat die Jury zwölf Beiträge ausgewählt, die am Abend zur Abstimmung standen. Schließlich ging es nicht nur um den Hauptpreis der Jury, den Goldenen Toaster, auch den Publikumsliebling galt es zu küren. Ein bunt gemischtes Programm hatte die Jury zusammengestellt. Animationen und Spielfilme gab es zu sehen, lustige Streifen liefen über die Leinwand und solche, die zum Nachdenken anregen. „Die Gedanken sind frei“ beispielsweise, den Urte Zindler von der Kunsthochschule Kassel geschaffen hat. Unterlegt mit der Musik des gleichnamigen Volksliedes ließ sie die Zuschauer in die irreale Welt einer dementen, älteren Dame eintauchen. Ein Film, der viele Zuschauer beeindruckt hat, auch wenn er in der Publikumswertung knapp auf dem undankbaren zweiten Platz landete. Nun aber zu den Preisträgern des gestrigen Abends. Keine leichte Entscheidung, wie Matthias Spehr, Jurymitglied und Moderator des Abends, die Zuschauer wissen ließ: „Es gab eine ganz enge Spitze, fünf Favoriten, zwei davon im engsten Raum.“ Schließlich geht es aber auch um viel, um den Wanderpokal „Golden Toaster“ nämlich, „der vor nunmehr 13 Jahren von der Golden Toaster Company ins Leben gerufen wurde.“ „Hürdenlauf“ lautet der Titel des Typofilms von Isabella Trybulla aus Wismar, den die Jury mit dem 3. Platz belohnte. Bei Typofilmen handelt es sich um kurze Animationsstreifen, bei denen Buchstaben in Szene gesetzt werden. In ihrem knapp vierminütigen Film ließ Isabella Trybulla ihre Protagonistin gekonnt einen Hürdenlauf über die Buchstaben just dieses Wortes absolvieren. Einen kleinen Hürdenlauf durchs Publikum musste die Studentin dann selbst zurücklegen, um ihren Preis auf der Bühne entgegenzunehmen. „Jetzt wird’s didaktisch“, leitete Spehr zum Zweitplatzierten des Abends über. „Regeln der Filmkunst“ nannte Holger Löwe seinen Film, den er mit Studenten der Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) drehte und in dem er nicht nur den eingangs erwähnten „Drink in einem Zug“ satirisch in Szene setzte. Mit seinem „Leitfaden für junge Filmschauspieler“ strapazierte er das Zwerchfell der Zuschauer und konnte sich in der Gunst der Jury auf den zweiten Platz schieben. „Der Film“, so Spehr, „macht selbst Laien mit Dingen vertraut, die für einen guten Film nötig sind.“ Stimmt. Immerhin kenne sogar ich jetzt die wichtigsten Sätze: „Oh mein Gott“ und „Es ist nur eine Fleischwunde!“ Crashkurs absolviert, hurra, jetzt werde ich Filmemacher! „Sehr originell, sehr toll, sehr vielschichtig“, zeigte sich Matthias Spehr im Namen der Jury von dem Sieger des Festivals beeindruckt. Aus dem Wasser in die Luft, vom Land in die Großstadt, vom Regentropfen zur Welle entführte uns Anja Großwig in nur knapp zweieinhalb Minuten in eine beeindruckende Vielzahl liebevoll und detailliert animierter Szenen. Leider konnte die Erstplatzierte vom Caspar-David-Friedrich-Institut (CDFI) in Greifswald heute nicht anwesend sein, um den Preis für ihren Film „StundenSekunden“ selbst in Empfang zu nehmen. Aus den Händen ihres Professors Michael Soltau, der den „Golden Toaster“ stellvertretend entgegennahm, dürfte sie sich aber mindestens genauso über ihren Sieg freuen. Doch zurück zum Publikumspreis, für den es neben Ruhm, Ehre und einem bunten Strauß Blumen zusätzlich ein Utensil gab, auf das wohl kaum ein Filmemacher verzichten kann: einen echten Regiestuhl. „Es geht um alles, es geht um diesen wunderbaren Stuhl“, bekräftige Matthias Spehr. Jury und Publikum lagen heute nicht weit auseinander und so heißt der glückliche Gewinner, der bei seinem nächsten Dreh auf der knallroten Sitzgelegenheit Platz nehmen kann, Holger Löwe. Glückwunsch! Was wir in der Zukunft vom Publikumspreisträger erwarten dürfen? „In erster Linie den eigentlichen Film“, verspricht der freischaffende Filmemacher und Dozent an der HMT. „Eine Mediensatire, die unter dem Arbeitstitel ‚Supershow‘ laufe“. Der heute gezeigte Kurzfilm sei eigentlich nur ein „Abfallprodukt“ dieses Projekts – man darf also durchaus gespannt sein! Während es im Li.Wu. Filmgenuss pur gab, dürften wenige Hundert Meter weiter in der Ulmenstraße die Köpfe geraucht haben. Beriet doch hier der StudentINNenrat der Universität Rostock (StuRa) in der ersten Lesung den Haushaltsentwurf fürs nächste Jahr, in dem es auch um den Fortbestand der Kulturwoche geht. Allen Gerüchten und Unkenrufen zum Trotz scheint es nach ersten Informationen mit der Kulturwoche auch 2011 weiterzugehen, sodass wir uns wohl auf eine 14. Auflage des StudentenFilmFestes „Goldener Toaster“ freuen dürfen. Bevor es soweit ist, sei noch einmal auf ein weiteres Highlight der diesjährigen Kulturwoche hingewiesen. Am Freitag ist um 20 Uhr im MOYA der „Club der toten Dichter“ mit Vertonungen von Rilke zu Gast.
11. November 2010 | Weiterlesen
„Die lustige Witwe“ im Volkstheater Rostock
Am Samstagabend wird ein neues Stück Premiere im Volkstheater Rostock feiern. Ein guter Zeitpunkt also für eine kleine Einführung. Traditionell lädt das Volkstheater dazu eine knappe Woche vor der Premiere alle Interessierten in das Intendanzfoyer des Theaters ein, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, dem Regisseur Fragen zu stellen und anschließend eine Bühnenprobe zu besuchen. So auch an diesem Montag. Wobei das Stück, genauer die Operette, eigentlich an sich gar nicht mehr so neu ist. Denn „die lustige Witwe“ von Franz Léhar wurde bereits im Dezember 1905 in Wien uraufgeführt. Zum Vorgespräch erschien neben dem Regisseur Mirko Bott auch die Kostümbildnerin Manuela Schröder. Für Schröder hat das Stück eine traurige Note, denn ihr Mann, Ulrich Schröder, der das Bühnenbild entworfen hat, ist im August verstorben und kann das Ergebnis seiner Arbeit leider nicht mehr selbst erleben. Ulrich Schröder ist übrigens alles andere als ein Unbekannter und seinen Arbeiten dürfte fast jeder schon einmal, wenn auch unbewusst, begegnet sein. Schließlich entwarf er lange Zeit Bühnenbilder für eine Vielzahl von Serien im deutschen Fernsehen, wie z.B. der Schwarzwaldklinik. Für alle, die mit dem Inhalt der Operette nicht vertraut sind, hier eine kleine Zusammenfassung: Die Handlung spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris, denn dort lebt Hanna Glawari – die lustige Witwe. Diese hat den Hofbankier des imaginären Fürstentums Pontevedro geheiratet und nach seinem Tod in der Hochzeitsnacht dessen Vermögen geerbt. Das Problem an der Sache: Geht dem Fürstentum das Vermögen verloren, weil Hanna einen Pariser heiratet, wäre der Staat bankrott. Aus diesem Grund soll die Witwe mit dem Graf Danilo Danilowitsch verkuppelt werden. Danilowitsch ist aber tatsächlich an ihr interessiert und möchte nun natürlich den Eindruck vermeiden, er würde nur des Geldes wegen um sie werben. Eine ganz schön verzwickte Angelegenheit also. Wie das ganze am Ende ausgeht? Das müsst Ihr schon selbst herausfinden. Für Regisseur Mirko Bott ist es nicht die erste Begegnung mit der lustigen Witwe. Einmal spielte er schon selbst als Statist mit und vor gut vierzehn Jahren war es seine erste große Inszenierung in Hamburg. Im Nachhinein hat er den Eindruck, damals zu jung gewesen zu sein, um die emotionalen Verwicklungen des Stücks wirklich zu begreifen. Heute verspricht er aber dennoch, trotz vertiefter Auseinandersetzung mit der Thematik, ein lockeres, unterhaltsames und temporeiches Stück. Die Frage, wie modern die Inszenierung denn sei, beantwortete er mit einem klaren „gar nicht!“ Und weiter: „Ich inszeniere Operetten grundsätzlich klassisch“. Jeder, der vielleicht aufgrund der Plakatwerbung, eine moderne Version der lustigen Witwe befürchtet hat, kann sich also entspannen, denn es wird ein klassisches Art Déco Bühnenbild geben, sowie Schauspieler in Abendkleid und Frack. „Das Plakat ist einfach nur dazu da, um Karten zu verkaufen“, kommentierte Bott die Werbung mit einem Augenzwinkern. Die Premiere ist an diesem Samstag um 19:30 Uhr im Großen Haus des Volkstheaters. Wer es nicht schafft dort zu sein, hat aber selbstverständlich auch in den kommenden Wochen noch genügend Gelegenheit das Stück zu sehen. Es verspricht jedenfalls, ein unterhaltsamer Abend zu werden. Foto 3: Dorit Gätjen, VTR
10. November 2010 | Weiterlesen
IHK zu Rostock vergibt 11. Schulpreis 2010
Wer hätte das gedacht, die Industrie- und Handelskammer zu Rostock (IHK) rockt! Eigentlich hatte ich eine gediegene Preisverleihung erwartet, auf der die Auseinandersetzung der Teilnehmer eines Schülerwettbewerbs mit dem Thema Beruf und Wirtschaft gewürdigt wird. Die Zutaten dafür stimmten zumindest: Der Bildungsminister von Mecklenburg-Vorpommern Henry Tesch war anwesend, Blumensträuße, fotogene Riesenschecks und ein Büfett waren vorbereitet. Auch an den musikalischen Rahmen war gedacht. Der allerdings verlieh der Vergabe des 11. Schulpreises der IHK am Dienstag eine besondere Note. Denn die Les Bummms Boys heiterten die Veranstaltung gleich zu Beginn mit zwei fröhlich-frechen Songs auf. Der Auftakt war geglückt. Die Ohren der Gäste – größtenteils Schüler – dürften nun auch für Themen wie unternehmerisches Denken und wirtschaftliche Zusammenhänge geöffnet worden sein. Denn hier ist Aufklärung nötig, betonte der Bildungsminister. Angesichts des demografischen Wandels und des drohenden Fachkräftemangels im Land beschäftigt auch ihn die Frage, „wie man für wirtschaftliche Themen einen Zugang für Schülerinnen und Schüler ermöglichen kann.“ Sie müssten, so Henry Tesch, „neugierig gemacht, begeistert werden und selbstständig aktiv werden.“ Initiativen, die dieses Ziel verfolgen, möchte die IHK zu Rostock mit ihrem Schulpreis würdigen. Aus diesem Grund hat sie in diesem Jahr bereits zum elften Mal in ihrem Kammerbezirk den Schulpreis ausgelobt. „Mit unserem IHK-Schulpreis wollen wir dazu beitragen, dass sich Schülerinnen und Schüler für Projekte und Methoden, die wirtschaftliches Wissen und die Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge vermitteln, interessieren“, sagte die Vizepräsidentin der IHK zu Rostock Doreen Jacobsen anlässlich der Preisvergabe. 16 Schulen beteiligten sich mit insgesamt 21 Projekten. Am überzeugendsten präsentierten sich Tu Tran Thi Ngoc, Phuong Mai Nguyen, Niko Hübner und Jan Erik Merten vom Ostseegymnasium Rostock. Mit dem Projekt „HRO im Ohr“ gewannen die Zwölftklässler den 1. Preis. Seit zwei Jahren arbeiten sie als Schülerfirma schon an ihrem Audio-Guide für Rostock. Gegen eine kleine Leihgebühr bieten sie Touristen einen Mp3-Player an, mit dem sie unsere Hansestadt individuell entdecken und dabei Wissenswertes über ausgewählte Sehenswürdigkeiten erfahren können. Eine deutsche Version wurde schon hergestellt, erzählen die Schüler, eine englische steht kurz vor der Fertigstellung. Auch auf Russisch und später eventuell auch Spanisch und Schwedisch soll der Audio-Guide über Rostock informieren. Kontakt mit Hotels und der Tourismuszentrale hat die Schülerfirma bereits aufgenommen. In zwei Wochen soll der Testlauf beginnen. „Das größte Ziel“, so Tu Tran Thi Phuong über das Projekt, „war es wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Wir haben hautnah Erfolge und Misserfolge erlebt. Wir haben gelernt, uns zu präsentieren, Bilanzen zu erstellen und Geschäftsbriefe zu verfassen.“ Auch Marita Noetzel ist sichtlich stolz auf ihre Schüler. In einem Wahlpflichtkurs hat die AWT- und Geografielehrerin das Projekt begleitet. „Sie sind dadurch gereift. Es hat sich sehr positiv auf ihre Persönlichkeitsentwicklung ausgewirkt“, freut sie sich über den Erfolg von „HRO im Ohr“. Mit dem ersten Platz beim IHK-Schulpreis hatten die Schüler dennoch nicht gerechnet. Die 1.500 Euro wollen sie in Mp3-Player investieren. Die „Tick Schüler GmbH“ vom Gymnasium Sanitz kann sich über den zweiten Platz und 1.000 Euro, die „Wunderwachs Schüler GbR“ von der „Schule am See“ in Satow über den dritten Platz sowie ein Preisgeld von 500 Euro freuen. Für die „Circus Barley junior Schüler GbR“, die bereits bei der diesjährigen Landesmesse für Schülerfirmen den ersten Preis gewann, gab es einen Sonderpreis.
10. November 2010 | Weiterlesen
Tischball Schnupperveranstaltung im Rathaus
Nanu, Tischtennis mitten in der Rathaushalle? Ist das die neue Pausenbeschäftigung für Stadtangestellte? Nein, dabei handelt es sich um eine Veranstaltung des Blinden- und Sehbehinderten-Vereins Mecklenburg-Vorpommern, dem BSVMV. Und es wurde auch nicht Tischtennis gespielt, sondern Tischball. Tischball ist ein Sport, der in den 1960ern vom Kanadier Joe Lewis erfunden wurde. Der Blinde Lewis wollte ein Spiel haben, das sowohl zur Erholung, als auch zu Wettkämpfen gespielt werden kann und für das man nicht sehen können muss. International bekannter wurde der Sport, der auch als Showdown bekannt ist, durch die paralympischen Spiele 1980. Für das Spiel, das sowohl blinde als auch sehende Menschen spielen können, braucht man zuallererst eine Platte, die der vom Tischtennis nicht unähnlich ist. Der Tisch ist etwas größer und von einer 14 cm hohen Bande umgeben. An jeder Seite des Tisches gibt es ein Netz, das Tor. Ziel der Spieler ist es, Punkte zu erreichen. Diese können natürlich durch Tore, aber auch durch Fehler des Gegners gewonnen werden. Jeder Spieler trägt eine blickdichte Brille und hat einen Holzschläger in einer Hand. Die andere Hand darf nicht ins Spiel eingreifen. Der Spielball enthält Metallstücke, wodurch er rasselt. So kann der Ball geortet und auf die Seite des Gegners geschlagen werden. Schiedsrichter der Spiele im Rathaus war Torsten Resa vom DBSV, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Der DBSV fördert die Verbreitung der Sportart in Deutschland. „Sie vermehrt sich erst seit den letzten drei Jahren. Momentan gibt es 15-20 Platten in Deutschland und der Sport ist selbst in der Blindenszene noch recht unbekannt“, sagt Resa. Im März 2011 findet die erste deutsche Meisterschaft im Tischball statt. Gudrun Buse, die Vorsitzende der Gebietsgruppe Rostock vom BSVMV, findet die Sportart sehr spannend und freut sich auch über die gute Resonanz. Viele Sehbehinderte wollten das Spiel selbst mal ausprobieren, sogar Gäste aus Waren und Güstrow waren angereist. Ob es jedoch auch bald eine Platte in Rostock gibt, ist fraglich. „Einerseits ist eine Kostenfrage, aber andererseits braucht man auch viel Platz. Und solche Räumlichkeiten stehen uns nicht zur Verfügung.“ Das erste Spiel am Montag gewann Udo Ramlow aus Rostock. Der Mann, der nur hell/dunkel sehen kann, findet das Spiel sehr gut. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn auch der Ball manchmal schwer zu orten ist. Teilweise hat man nicht mal bemerkt, wenn der Ball im Tor ist.“ Er könnte sich vorstellen, den Sport regelmäßig zu betreiben, aber für eine private Platte habe auch er keinen Platz. Showdown ist ein teilweise sehr schneller Sport, und doch steht das Vergnügen im Vordergrund. Und so bringt es auch Torsten Resa sehr gut auf den Punkt, wenn er sagt: „Tischball ist der ideale Sport, um mal eine ruhige Kugel zu schieben.“
9. November 2010 | Weiterlesen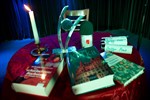
16. Poetry Slam im Ursprung
Rappelvoll war es am Montagabend im Ursprung, der Kleinkunstbühne am Alten Markt. Sogar bis auf den Bühnenrand drängten sich die Gäste. Zum Poetry Slam der 23. Rostocker Kulturwoche waren sie gekommen. Der Dichterwettstreit ist mittlerweile zu einer festen Institution der beliebten Veranstaltungsreihe geworden. Bereits zum 16. Mal hatte das Kulturreferat vom AStA der Universität Rostock ihn für all jene organisiert, die ihr schriftstellerisches Talent vor einem Live-Publikum testen wollen. Traditionell wurde der Abend mit der Entzündung einer Kerze eröffnet. Sie soll nicht nur für allgemeine Erleuchtung sorgen, sondern verhalf auch dem Silbernen Punkt zu noch größerem Glanz. Der Silberne Punkt ist die bei Rostocker Poetry-Slammern begehrte Trophäe, die es einmal im Semester zu gewinnen gibt. Doch um den kleinen Wanderpokal bei sich im eigenen Heim aufstellen zu dürfen, müssen die Wettbewerbsteilnehmer zuvor die Zuschauer überzeugen. Denn nur, wer von ihnen die meisten Stimmen erhält, bekommt diesen Publikumspreis. Zehn Beiträge hatten die Gäste im Ursprung zu beurteilen. Elf Poeten traten gegeneinander an. Richtig gerechnet: Ein Beitrag wurde von zwei Teilnehmern gestaltet. Die beiden Studenten Erik Malter und Thomas Linke hatten beide die Absicht beim Poetry Slam mitzumachen und beide hatten auch schon einen Anfang für ihren eigenen Text verfasst. In einem Café entschlossen sie sich, ihre Ideen zu einer gemeinsamen Geschichte zu entwickeln. Deren Protagonist heißt Tom. Auf der Suche nach Erleuchtung treibt es ihn in eine Bar. Dort trinkt er so viel, dass seine Umgebung bald auf ihn einzudringen scheint. Ob sie mit dieser Geschichte die Zuschauer beeindrucken können? Erfahrene Poetry-Slammer wissen, dass es nicht nur auf den Text allein ankommt, sondern immer auch die „Performance“ eine gewisse Wirkung beim Zuschauer hinterlässt. Auch Thomas Linke nimmt nicht zum ersten Mal an diesem Poetry-Slam teil und so hat er sich mit seinem Partner vorher schon einige Gedanken über die Darbietung ihrer Geschichte gemacht. „Wir wollten das Publikum ansprechen und haben deshalb besonders betont vorgetragen. Außerdem haben wir noch einige spielerische Elemente eingebaut“, erklärt der vierundzwanzigjährige Lehramtsstudent für Germanistik, Geschichte und Darstellendes Spiel später. Fehlt noch etwas für einen siegreichen Beitrag beim Poetry-Slam? Ach ja, die Botschaft. Was wollen die beiden Autoren dem Zuhörer mit ihrem Text eigentlich mitteilen? „Verschwende deine Energie nicht für die Suche nach Erleuchtung, denn sie steckt in den Momenten, die du beobachtest“, bringt Thomas Linke sie auf den Punkt. Diese Erkenntnis dürfte doch auch bei vielen Besuchern des Ursprungs eigene Erinnerungen wecken und Gedanken anregen. Diese Voraussetzungen plus die doppelte Manpower – da müsste doch der Silberne Punkt drin sein. Aber die Konkurrenz war groß. Wer sich das Teilnehmerfeld anschaute, konnte den Eindruck gewinnen, dass das Dichten und die Schriftstellerei vor allem etwas für Herren sei. Kerstin Borchardt war die einzige Frau, die an diesem Abend auf der Poetry-Slam-Bühne stand. Ein Mann, ein Schokoladenweihnachtsmann, inspirierte sie zu einem Gedicht. Liebe, glücklich oder unglücklich, war überhaupt eines der großen Themen beim 16. Poetry Slam. André Marschke schilderte seine Liaison zu Angela Merkel und konnte mit Sprachwitz und einer sympathische Bühnenpräsenz punkten. Sven Lübbe las aus seiner sehr aufschlussreichen wissenschaftlichen Abhandlung, in der er das Projekt „Schöpfung“ und die Rolle von Adam und Eva analysierte. Er glänzte mit originellen Schlussfolgerungen und profunden Bibelnachweisen. Beim Publikum fanden die beiden Vorträge großen Anklang. Mit viel Beifall und dem dritten (Sven Lübbe) sowie dem zweiten Platz (André Marschke) belohnten sie die beiden Poetry-Slammer. Den ersten Platz vergaben die Zuschauer übrigens an Erik Malter und Thomas Linke. Der Silberne Punkt wird also in den nächsten Monaten bei ihnen ein neues Zuhause finden. Ob sie ihren Preis im Frühling bei einem 17. Poetry Slam verteidigen können, ist noch ungewiss, teilte der Moderator Christoph Lenz mit. Eine wichtige Weiche dafür stellt morgen das Studentenparlament der Universität Rostock, indem es über die zukünftige Finanzierung der Rostocker Kulturwoche entscheidet.
9. November 2010 | Weiterlesen



