Neueste Nachrichten aus Rostock und Warnemünde

Kulturwoche 2010: Kunstkonzentrat in der Alten Gerberei
Unverdünnt und hoch konzentriert konnten Besucher der Alten Gerberei am Samstagabend Kunst in verschiedensten Ausdrucksformen genießen. „Ich bin wegen der Balkanmusik hergekommen“, erzählte Yvonne Schmitz. Die Promotionsstudentin schätzte besonders „die gute Mixtur“ der Veranstaltung. „Sie bietet viel Neues, worauf man sich gerne einlässt“, zeigte sie sich auch an den anderen Künstlern des Kunstkonzentrats der 23. Rostocker Kulturwoche interessiert. Wie viele Besucher genoss auch sie die angenehm entspannte Atmosphäre am Lagerfeuer auf dem Gelände am Rande der Östlichen Altstadt. Um die Balkanmusik kümmerte sich an diesem Abend A Glezele Vayn. Die Lieder der vier Musiker aus Berlin stammten aber nicht nur aus den Ländern des Balkans. Musik aus den Alpen und Klezmer aus Osteuropa gehörten ebenso zu ihrem Repertoire. Neben traditionellen Stücken präsentierten sie auch eigene spritzige Texte und Melodien. Mit Kontrabass, Akkordeon und Percussion sorgten Johannes, Szilvia und Jacobus beim Publikum für viel Vergnügen. Und auch Achim war an seiner Klarinette hervorragend aufgehoben und begeisterte bestimmt nicht nur alte Männer, auch wenn er in dem Lied „Klarinettenhass“ Zweifel daran aufkommen lassen wollte. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt des Abends war Daniel Malheur mit seinem Monokel-Pop. Ausgestattet mit einem Monokel und auch sonst im Stile des Establishments der 20er Jahre gekleidet, trug er Schlager aus dieser Ära vor. Begleitet wurde er dabei von Tanzorchesteraufnahmen aus seiner Schellack-Platten-Sammlung, die er mit einem Winchester-Trichter-Grammophon abspielte. „Ich bin nur Interpret“, warnte er das Publikum vor den erotisch-anzüglich, sehr doppeldeutigen und nicht immer politisch korrekten Liedtexten. Aber worüber die Zuhörer vor 90 Jahren schon gelacht haben, sorgte auch beim Publikum des Kunstkonzentrats für Schmunzeln. Auch Philip Heinke und Paul Lücke unterhielten die Besucher auf der kleinen Bühne in der Alten Gerberei. Sie waren für die darstellende Kunst zuständig und zeigten ausgewählte Szenen aus Friedrich Schillers „Die Räuber“. Die beiden HMT-Studenten hatten sie im Rahmen ihrer Schauspielausbildung erarbeitet und werden sie noch in dieser Woche bei ihrer Abschlussprüfung vortragen. Malereien, Grafiken, Fotografien und Skulpturen durften beim Kunstkonzentrat natürlich auch nicht fehlen. In der Galerie auf Zeit hatten die Rostocker Künstler Christoph Chciuk, Paul Glaser, René Winter, Felix Fugenzahn und Juliane Zerbe eine Auswahl ihrer neuesten Werke ausgestellt. Aber damit nicht genug der vielen Kunst. Zwei „Kunstfilme“, die zuvor aus Vorschlägen von den Teilnehmern einer Umfrageaktion ausgewählt wurden, rundeten das hoch konzentrierte Kunst- und Kulturangebot an diesem Abend ab. Für den neunundzwanzigjährigen Ulf Liebal, der gerade an seiner Doktorarbeit an der Universität Rostock schreibt, war das Kunstkonzentrat eine gelungene Veranstaltung. Auch die Rostocker Kulturwoche als Ganzes betrachtet er als „große Bereicherung“, die er „gerne nutzt“. „Sie bringt Vielfalt in das kulturelle Leben Rostocks“, lautet sein positives Urteil. Bereits vor zwei Jahren hatte er als Fagottspieler des Freien Studentenorchester Rostock selbst an einem Konzert der Veranstaltungsreihe teilgenommen.
8. November 2010 | Weiterlesen
Mitternacht-Spaghetti in der Bühne 602
„Wie heißt noch mal der Dings?“ „Der Dings?“ Ja, der halt, weißt du?“ „Nein, weiß ich nicht.“ Szenen einer Beziehung. Erst, wenn man aneinander vorbeiredet und über Umwege doch noch zueinanderfindet, dann ist es wohl Liebe. Ungefähr darum ging es im Programm Mitternacht-Spaghetti und um noch viel mehr, zum Beispiel darum, was bei Hapag-Lloyd auf den Kotztüten steht. „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ nennt sich das Kabarett-Duo Wiebke Eymess und Fridolin Müller. Im Rahmen der 23. Rostocker Kulturwoche spielten sie in der Bühne 602 auf. Und wie bisher bei allen Terminen, war es auch diesmal wieder rappelvoll. Die Rostocker nehmen die Kulturwoche also weiter sehr gut an. Auf der Bühne fehlten zwar die Nudeln und das Geld, auch ein Fenster war nicht auszumachen, dafür aber wenigstens eine Bank. Diese war allerdings auch nur improvisiert, ein paar Bretter auf zwei Stühle geklebt, fertig ist die Sitzgelegenheit. Außerdem zeichnete sich ab, dass es sehr musikalisch werden sollte. Gitarre, Konzertina – eine kleine Form der Ziehharmonika – und eine weiße Ukulele standen bereit und sollten während der auch Show reichlich bespielt werden. Wie schon bei Michael Sens ging es auch heute wieder viel um Liebe und die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Dadurch jedoch, dass Wiebke und Fridolin ein Pärchen spielten, hatte man weniger das Gefühl, einen Vortrag zu hören, sondern war wirklich mittendrin. In den Gesprächen waren die beiden immer sehr gegensätzlich. Wiebke neigte zum Philosophieren und zur Romantik, Fridolin war eher der nüchterne Typ. Besonders in den Songs zeigten sich dann aber auch das Gefühl und die Liebe zueinander. So verglich Wiebke wunderschön bildlich: „Was für den Jäger das Ende der Schonzeit ist, das bist du für mich“, was Fridolin mit einem „Für dich leg ich Magda at Acta“ quittierte. Musikalisch vielfältig wurde später auch noch ein Kazoo und eine Nasenflöte ausgepackt, wunderschön im Duett gesungen und sogar mit Keyboardbegleitung gerappt, übrigens zum Thema Bielefeld. Nebenbei konnte man dann auch noch was lernen, etwa dass wir täglich 253.000 Tonnen Fisch verzehren. Auch wenn das Programm stellenweise sehr ruhig, fast schon bedächtig war, gab es doch häufig genug auch etwas zum Lachen. Die Gegensätze zwischen langsamen, stillen Passagen und den typischen Partnerdialogen, wie ich sie fast genauso aus meinem Freundeskreis kenne, haben die beiden sehr gut hinbekommen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass es zum Ende viel Applaus und unzählige Zugaben gab. Fast schon wie auf einem Rockkonzert verließen die beiden Protagonisten die Bühne, die Leute klatschten und dann gab es doch noch eine Nummer. Nach der Show musste aber das Wichtigste noch geklärt werden: Sind die beiden wirklich ein Paar? Auf der Homepage des Duos heißt es: „Ein real-fiktives Liebespaar.“ Doch was heißt das? „Wir sind schon ein Paar, aber die Figuren auf der Bühne sind wir nicht. Da nehmen wir die Ideen mehr aus unserem Umfeld, als aus unserer Beziehung“, verraten mir die beiden. Wie lange die beiden jedoch schon zusammen sind, darüber herrscht Uneinigkeit beim Paar. Ungefähr drei bis vier Jahre müssten es sein. Erst kam die Idee, etwas zusammen zu machen, dann die Beziehung und schließlich das erste gemeinsame Programm. Der Name geht übrigens auf ein altes Sprichwort von Kurt Tucholsky zurück, was so viel wie „alles ist verloren“ bedeutet. Ein Verlust war der Abend jedoch auf keinen Fall. Und auf den Kotztüten von Hapag-Lloyd steht übrigens: „Vielen Dank für Ihre Kritik!“
8. November 2010 | Weiterlesen
Preisvergabe beim 20. Landesfilmfest MV 2010
Ein junger Mann will mit einem Bus nach Glashagen fahren. Glashagen? Gleich mehrere Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern tragen diesen Ortsnamen. Und natürlich landet der junge Mann im falschen. Aber damit nicht schlimm genug. Die Fahrt nach Glashagen entwickelt sich zu einem Horrortrip. Ungemütliche Gesellen tauchen in dem Dorf auf: Skinheads, ewig gestrige Ossis, dem Alkohol-Zugeneigte – so wie man sich die Dorfbewohner im Nordosten halt so vorstellt. Aus dieser Geschichte hat New X-iT, eine Gruppe aus zwanzig Rostocker Schülern und Studenten, unter der Regie des Politikwissenschaftsstudenten Helge Eisenberg einen fünfzehnminütigen Film gedreht. Am Wochenende war „Glashagen“ beim 20. Landesfilmfest Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. Das satirische „Roadmovie ohne Auto“ räumte hier gleich mehrere Preise ab. Als einziger der insgesamt 42 Beiträge des Landesfilmfestes erhielt er von der Jury die volle Punktzahl und gewann so den Hauptpreis. Auch die kleine Trophäe für die beste Filmidee konnte Yves Bartell entgegennehmen. Der Schüler der Rostocker Werkstattschule ist einer der beiden Hauptdarsteller und freut sich nun, dass „Glashagen“ im nächsten Jahr auch auf dem Bundesfilmfestival Spielfilm in Wiesbaden gezeigt wird. Bleibt zu hoffen, dass der Film dort bei Jury und Publikum genauso gut aufgenommen wird wie im Peter-Weiss-Haus in Rostock. Denn auch die Zuschauer des Landesfilmfestes Mecklenburg-Vorpommern honorierten den Kurzspielfilm mit einem zweiten Platz in der Publikumswertung. Damit musste sich „Glashagen“ nur dem zweiten großen Abräumer des Wochenendes geschlagen geben: „Nefastus“. Dessen Macher Kristian Erdmann, Anne Mantei, Stephan Kretschmann, Holger Salisch, Kathleen Teichmann und Lutz Teichmann dürfen nun ein vom Publikum gefülltes kleines rosafarbiges Sparschweinchen als Preis mit nach Hause nehmen. Und was hat dem Publikum an der Geschichte des einsamen Postboten, der das Postgeheimnis verletzt und in den Briefen der Menschen lebt, gefallen? Es lag vielleicht an der ungewohnten Machart des Films. „Wir haben uns mit einem alten Medium, dem Stummfilm beschäftigt. Das ist ein sehr ästhetisches Medium und spricht vielleicht auch besonders die Jüngeren an“, vermutet Stephan Kretschmann. Anne Mantei ergänzt: „Die Sprache fällt weg. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Da muss man mit viel subtileren Mitteln arbeiten.“ Die beiden absolvieren gerade eine Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton. Die Idee zu diesem Film ist in einem Kurs entstanden, der von Mark Auerbach geleitet wurde, der gemeinsam mit der HMT-Absolventin Luise Heyer auch die Hauptrolle übernahm. Da die Vorbereitungen zu „Nefastus“ im Vergleich zu den anderen Wettbewerbsteilnehmern nach Meinung der Jury die aufwendigsten waren, wurde auch diese Leistung des Filmteams mit einem Sonderpreis gewürdigt. Wer nach diesem Wochenende weitere Filme made in Mecklenburg-Vorpommern sehen möchte, der sollte sich den kommenden Mittwoch vormerken. Beim Studentischen Kurzfilmfestival „Golden Toaster“ im LiWu wird dann eine Auswahl aktueller Arbeiten von Studierenden der Hochschulen des Landes gezeigt.
7. November 2010 | Weiterlesen
9. Lichtwoche in Rostock geht zu Ende
Wer sich im Laufe dieser Woche in die Rostocker Innenstadt verirrte, der fand eine bunt erleuchtete Kröpeliner Straße inklusiv Neonbäumen vor, schließlich war es wieder Zeit für die Lichtwoche der Stadtwerke Rostock AG. Nach knapp einer Woche ging diese am gestrigen Abend schon wieder viel zu schnell zu Ende, aber natürlich nicht ohne ein großes Finale aus Bühnenshows und Feuerwerk. Im Laufe der Woche gab es bereits viel zu erleben im Rahmen der Veranstaltung. So reichte das Programm von Vorträgen wie „Kräuter im Licht“, über die Buchpremiere des neuen Rostocker Zorenappels bis hin zu Ausstellungen wie Keine Kunst ohne Licht und musikalischen Beiträgen bei „Kunst auf der Treppe“. Seit Freitag wurde darüber hinaus ein Showprogramm auf dem Universitätsplatz geboten, das mit Puppentheater und Feuershow Jung und Alt begeistern konnte. Selbstverständlich gab es gegen die Kälte auch Glühwein bzw. Kinderpunsch für die Kleinen. Dieser wurde wie in den Vorjahren für einen guten Zweck verkauft und am Ende durften sich die Veranstalter über eine Rekordeinnahme von über 4.000 Euro freuen. Für das große Finale am Samstag wurde die Bühne dann noch einmal zum Zentrum des Geschehens. Das Programm reichte von Tanzvorführungen über Percussion Rhythmen bis hin zu Artistik. So präsentierte z.B. die Jugendkunstschule Arthus e.V. Rostock eine Reihe großartiger Tänze. Auch eine wirklich beeindruckende Breakdance-Aufführung gab es zu bestaunen. Kein Wunder, immerhin hat einer der Tänzer bereits einen Weltmeistertitel in der Kategorie Hip-Hop gewonnen. Anschließend führten Ruben und Sebastian, die Flugträumer, eine Feuershow der Extraklasse vor. Egal ob alleine mit bis zu fünf oder zu zweit mit bis zu sieben brennenden Keulen jonglierend gelang es ihnen das Publikum völlig in ihren Bann zu ziehen. Erst recht als sie, einer auf den Schultern des anderen stehend, mit auf beiden Seiten brennenden Stäben hantierten. Movimento heizte den Zuschauern mit brasilianischen Percussioninstrumenten ein. Die größtenteils aus Studenten bestehende Gruppe hat inzwischen auch schon ihre erste CD mit dem Titel „Offbeat“ aufgenommen. Nachdem es von Movimento die Samba Rhythmen zu hören gab, wurde von den Tänzerinnen von „Samba de Brasil“ anschließend das visuelle Pendant dazu präsentiert. So kam trotz der kühlen Temperaturen ein Stück Sommer zurück nach Rostock. Vielleicht sollten beide Gruppen einmal über eine Zusammenarbeit nachdenken. Das große Finale der Veranstaltung war aber das Barockfeuerwerk, das das Hauptgebäude der Universität in den verschiedensten Farben erstrahlen ließ und auch vielen der Zuschauer leuchtende Augen bereitete. Es war der krönende Abschluss einer gelungenen Woche. Rostock darf sich nun auf das Jubiläum im nächsten Jahr freuen und da Bilder ohnehin mehr als Worte sagen, gibt es hier noch einige Impressionen vom gestrigen Abend zu sehen.
7. November 2010 | Weiterlesen
Festveranstaltung zum 200. Geburtstag Fritz Reuters
Schlechte Schulleistungen, abgebrochenes Studium, Trunksucht und jahrelange Gefängnisaufenthalte – unter diesen Vorzeichen ist Fritz Reuter (dennoch) zum bedeutendsten niederdeutschen Schriftsteller und zu einem der meistgelesenen Autoren seiner Zeit in Deutschland geworden. Seine literarischen Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und weltweit veröffentlicht. Mit seinen Geschichten und Gedichten spiegelte er nicht nur das mecklenburgische Wesen wider, sondern verhalf auch der norddeutschen Mundart als Literatursprache zu neuem Aufschwung. Heute vor 200 Jahren, am 7. November 1810, wurde Fritz Reuter in Stavenhagen geboren. Anlässlich dieses Jubiläums luden bereits am Freitag der Plattdeutsch-Verein „Klönsnack – Rostocker 7“, der Bund Niederdeutscher Autoren und der Mecklenburger Kulturbund zu einer Festveranstaltung in den Festsaal des Rostocker Rathauses. Der Ort war gut gewählt. Denn nur zwei Etagen tiefer, im Ratskeller ging der junge Student Fritz Reuter seinem Hang nach geselligen Vergnügungen nach und beteiligte sich an fröhlichen Gelagen. Doch sein Aufenthalt in Rostock war nur von kurzer Dauer. Lediglich von Oktober 1831 bis April 1832 studierte er hier nach dem Willen seines Vaters an der juristischen Fakultät. Während dieser Zeit wohnte er in einer klassischen Studentenbude in der Lagerstraße 46. Doch auch wenn Fritz Reuter nicht viel Zeit in unserer Hansestadt verbrachte, „Reuter und Rostock sind weder zu trennen, noch auf die Monate seines Studiums zu reduzieren“, war dem Oberbürgermeister Roland Methling in seinen Grußworten wichtig. Obwohl er sein Studium hier eher lustlos betrieb, eine Vorlesung in einem Brief an seinen Vater sogar als „schlecht, planlos, matt und verworren“ bezeichnete, fand der Dichter später auch lobende Worte für die Hansestadt. Mit Freude las Roland Methling als Beispiel einige Zeilen aus Reuters „Die Reise nach Konstantinopel“ vor, in der es heißt: „Jedem Mecklenburger geht das Herz auf und manchmal auch der Geldbeutel, wenn von Rostock die Rede ist.“ Der Name Rostock habe erstmals durch Fritz Reuters literarisches Schaffen eine weltweite Verbreitung bekommen, so der Oberbürgermeister über die Bedeutung des Dichters für die Stadt. Dass Rostock dies zu würdigen weiß, kann man in der Stadt gut erkennen. Hier trifft man vielfach auf Fritz Reuter. Straßen, Schulen, Apotheken, Gaststätten, Schiffe und sogar ein ganzer Stadtteil sind nach dem niederdeutschen Dichter benannt. Zum Repertoire des Volkstheaters, der Niederdeutschen Bühne Rostock, des Vereins „Klönsnack – Rostocker 7“ und vieler Chöre der Stadt gehören Texte von Fritz Reuter. Einen kleinen Einblick konnten die Gäste der Festveranstaltung in dem fast zweistündigen Programm bekommen. Werner Völschow rezitierte aus Reuters „Läuschen un Rimels“, mit dem der Dichter seinen literarischen Durchbruch hatte, und aus „Ut mine Stromtid“, einem dreiteiligen Roman, der als künstlerischer Höhepunkt des Dichters gilt. Die Rostocker Plattspräker trugen aus „Kein Hüsung“ vor und Uwe Snobkowski las aus „Geschichten üm Bäuker“. Zwischendurch erfreuten immer wieder musikalische Beiträge von den Warneminner Utkiekers die Gäste. Mit bekannten Liedern brachten sie das überwiegend ältere Publikum zum Klatschen, Schunkeln und Mitsingen. Dass man aber nicht erst 60 Jahre alt werden muss, um Fritz Reuter zu schätzen, demonstrierte Ole Stephan. Er besucht die dritte Klasse und lernt seit vier Jahren Plattdeutsch. Zum 200. Geburtstag des niederdeutschen Dichters hatte er einen Rap auf den Text „Lütt Matten, die Has“ vorbereitet, der ebenfalls mit viel Beifall von den Reuterfans aufgenommen wurde. Die große Popularität Fritz Reuters auch beim „einfachen Volk“ erklärt sich Wolfgang Mahnke, Vorsitzender des Bundes Niederdeutscher Autoren, mit der „herrlich natürlichen“ Darstellung der Figuren. „Für Reuter sind die Menschen etwas ganz Besonderes.“
7. November 2010 | Weiterlesen
9. Rostocker Lichtwoche - Laternenumzug und Lasershow
Seit knapp einer Woche läuft die 9. Rostocker Lichtwoche nun schon und somit nähert sie sich mit großen Schritten dem Ende. Am Freitag war daher auch zum ersten Mal die große Bühne aufgebaut und einige Höhepunkte erwarteten das Publikum. Das Geschehen spielte sich wie die ganze Woche schon rund um die zwei Zelte der Stadtwerke vor dem Uniplatz ab. An der Stelle, an der am Montag noch eine brennende Neun gehangen hat, stand nun die Bühne. Schon am Nachmittag sorgten kleinere Tanz- und Musikeinlagen für Unterhaltung. Aber wie es sich für eine Lichterwoche gehört, wurde es erst mit der Dunkelheit richtig spannend. Es war wirklich beeindruckend, wie viele Menschen am Laternenumzug teilnahmen. Angeführt vom Jugend-Musikkorps Rostock wurde vom Uniplatz zum Kröpeliner Tor, weiter durch den Park, über den Burgwall und zurück zur Bühne marschiert. Und während die Musik schon im Park verschwunden war, liefen immer noch Menschenmassen vom Uniplatz Richtung Kröpeliner Tor an mir vorbei. Die wenigsten waren wirklich mit Laternen bestückt. Überhaupt hatten die wenigsten Laternenträger die klassische Konstruktion mit einer Kerze gewählt. Häufiger waren Lichtstäbe, Leuchtarmbänder und dergleichen zu sehen. Wieder an der Bühne angekommen, wartete schon der Kasper auf die Kinder. Rumpelstilzchen wurde von Ulrike Hacker gespielt und ging natürlich auch diesmal wieder gut aus, da alle Kinder den Namen des kleinen Männchens wussten und auch laut ausriefen. Dann betrat mal wieder Arne Feuerschlund die Bühne, der den Besuchern schon seit Montag täglich mit seiner Feuershow einheizt. Doch anders als noch bei der Premiere ging diesmal einiges schief und es fielen auch schon mal brennende Keulen zu Boden, verletzt wurde niemand. Dafür zeigte er als Zugabe, wie er eine Biergartenbank auf dem Kinn balancieren kann. Das Highlight war wieder die große Lasershow, welche die Menschenmassen in buntes Licht tauchte. Und es war wirklich sehr voll. Einmal von einer Seite der Bühne zur anderen zu kommen, konnte schon gut und gern mal drei Minuten dauern. Und dadurch, dass die Kinder von ihren Eltern auf den Schultern getragen wurden oder auf den Tischen standen, konnte man nicht viel von der Bühne sehen. Zum Glück war das bei der Lasershow aber auch gar nicht nötig, denn das Licht erstrahlte ja gut sichtbar auf dem ganzen Uniplatz. Morgen wird es zum Abschluss der Lichtwoche 2010 noch Movimento, brasilianische Tänzerinnen und natürlich das große Barrockfeuerwerk geben. Danach müssen wir uns dann wieder selbst die dunklen Abende erhellen.
5. November 2010 | Weiterlesen
Flossenschwimmer in der Neptun Schwimmhalle
An diesem Freitag und Samstag ziehen die Flossenschwimmer wieder ihre Bahnen in der Rostocker Neptun Schwimmhalle. Zum 44. Mal wird der traditionsreiche Wettbewerb zum Saisonauftakt bereits ausgetragen und weitere Wiederholungen werden sicherlich in Zukunft folgen. Oberbürgermeister Roland Methling, der wieder die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen hat, konnte leider aus Termingründen nicht selbst anwesend sein. Nach einer kurzen Begrüßung ging es damit ohne Umschweife direkt los mit den ersten Disziplinen. Für die Schwimmer hieß es also Monoflossen angelegt und ab an den Start. Diese Flossenart wird standardgemäß beim Flossenschwimmen verwendet. Dabei befinden sich beide Füße in einer Flosse. Die daraus resultierenden Bewegungen im Wasser ähneln denen eines Delfins. Dabei werden durchaus beachtliche Geschwindigkeiten erreicht. Kaum sind die Sportler gestartet, haben sie auch schon eine Bahn zurückgelegt. Insgesamt 22 Wettkämpfe kommen an den beiden Veranstaltungstagen zur Austragung. Dabei werden verschiedene Distanzen in Einzel- und Staffelwertungen, sowie im Freistil und Streckentauchen zurückgelegt. In jeder Disziplin gibt es eine Einzelwertung, darüber hinaus geht der jeweils beste Schwimmer seines Vereins in die Teamwertung ein. Das Team, das die meisten Punkte aus allen Wettkämpfen erringt, darf am Ende den Wanderpokal für den Gesamtsieg entgegen nehmen. Darüber hinaus werden auch zwei Sonderpokale beim 400 Meter Streckentauchen der Herren (Detlef-Meyer-Gedächtnis-Pokal) und den 200 Metern Freistil der Damen (Pokal des Oberbürgermeisters) vergeben. Ein besonderer Anreiz also für die Schwimmer, noch einmal alles zu geben. 100 Sportler aus elf deutschen Vereinen sind für den Wettbewerb angereist, um der Konkurrenz davon zu schwimmen. Wieder mit dabei ist natürlich auch der Top-Favorit, der SC DHfK Leipzig, der zuletzt viermal in Folge den ersten Platz für sich beanspruchte. Auch in diesem Jahr soll selbstverständlich der Sieg her. Für den TSC Rostock 1957 dürfte es dagegen schwer werden, Platz zwei aus dem Vorjahr zu verteidigen oder gar die Leipziger zu schlagen, da sich einige der besten Schwimmer des Vereins krankmelden mussten oder von Berufs wegen verhindert sind. Ein Platz auf dem Podium wird dennoch angestrebt. Auch am morgigen Samstag wird es von 13 bis 17 Uhr für alle Interessierten eine ganze Reihe von Wettkämpfen zu sehen geben. Der Eintritt ist übrigens frei. Ab 19 Uhr wird die Abendveranstaltung mit Siegerehrungen und Pokalübergabe beginnen, bevor der 44. Internationale Rostocker Pokal im Flossenschwimmen gegen Mitternacht zu Ende gehen wird. Bis dahin dürfte auch entschieden sein, ob der SC DHfK Leipzig seinen 5. Titel in Folge gewinnen kann oder ob der TSC Rostock 1957 vielleicht doch ein Wörtchen mitreden konnte.
5. November 2010 | Weiterlesen
Das Casanova-Prinzip - Was Frauen hören wollen
Liebe, die Unterschiede zwischen Frau und Mann und Geschlechterrollen sind mit die beliebtesten Themen der Comedy. Wie man mit diesem Stoff niveauvoller umgehen kann, als zum Beispiel ein Mario Barth, zeigte Kabarettist Michael Sens am Donnerstagabend im gut gefüllten Ursprung. „Das Casanova-Prinzip – Was Frauen hören wollen“ – so der Titel des Programms. Und unter den ungefähr 100 Gästen waren tatsächlich ein paar mehr Frauen als Männer auszumachen. Dabei ist es doch für unser Geschlecht mindestens ebenso wichtig zu hören, was Frauen wollen. Michael Sens verkündete zu Beginn des Abends, dass es Kunst und Humor über Sex und Musik geben würde. Ziemlich gewagt, aber wenn man jemandem zutraut, so etwas zu schaffen, dann dem adrett gekleideten 47-Jährigen. Und so sollten im Laufe des Abends nicht nur Tricks und Kniffe für Mann und Frau verraten werden, sondern es gab auch viel Musik zu hören. Sens brillierte am Klavier, an der Gitarre und sogar Geige wurde gespielt. Der Künstler, der schon im Alter von 6 Jahren musikalisch ausgebildet wurde, spielte eine fantastische Version von Michael Jacksons „Smooth Criminal“. Mit charmanter Mimik und Gestik, vor allem aber mit Komplimenten brachte er das weibliche Publikum auf seine Seite. „Ich habe heute in der Stadt keine erotischen Frauen gesehen. Zum Glück ist jetzt aber die erotische Elite auf meinem Konzert.“ Tja, was Frauen halt so hören wollen … Vor allem Antje und Evi in der ersten Reihe waren von dem Kabarettisten angetan. So wurde vor allem seine oberkörperfreie Holzhackernummer mit viel Jubel und Johlen quittiert. Während der Show nahmen sie dann auch meinen Notizblock und schrieben ein „Michael Sens – einfach nur die Wahrheit“ hinein. Sens ging immer wieder auf die beiden ein („Evi, wir müssen über euren Getränkekonsum sprechen“) und fand sie sehr inspirierend, wie er mir im Anschluss verriet. Nur bei seiner Schlussnummer, einer Verknüpfung von klassischer Musik und einem Fußballspiel, hat der frenetische Jubel dazu geführt, dass, als Ravel am Ball war, nicht wie geplant der Bolero erklang. Aber diesen kleinen Hänger hat das Publikum verziehen, besonders natürlich Antje und Evi. Als Zugabe gab es noch einen Liebesbrief ans Publikum, den der Künstler während der Show mit seinem Herzen geschrieben habe. Ein gelungener Auftakt für die 23. Rostocker Kulturwoche, fand auch Organisator Daniel Karstädt. Vor 3 Jahren war Sens schon einmal hier aufgetreten, damals vor nur 30 Leuten. Auch der Vorverkauf für die anderen Veranstaltungen laufe sehr gut, so Karstädt. „Ich freue mich auf alles. Jeder Tag ist anders und immer wieder spannend.“ Der Organisator, der schon seit der ersten Kulturwoche im Jahr 1999 dabei war, ist in diesem Jahr wieder in Freiburg auf der Kulturbörse gewesen, um spannende Künstler zu finden. Noch bis zum 14. November gibt es an jedem Tag ein vielfältiges Kulturprogramm. Von Kabarett bis Konzert ist für jeden etwas dabei. Das genaue Programm findet ihr hier, weitere Berichte natürlich bei uns auf der Seite.
5. November 2010 | Weiterlesen
Erster Spatenstich für die Schulsanierung in Reutershagen
Normalerweise wird nicht jede Schulsanierung groß gefeiert. Anders am 3. November. Zum Start des deutschlandweiten Pilotprojektes waren neben Bürgermeister Roland Methling auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft nach Reutershagen gekommen. Demonstrationsbauvorhaben „Energieoptimiertes Bauen; Energieeffiziente Schulsanierung: Plus-Energie-Schule Rostock Reutershagen“, so der genaue Titel des Projekts. Doch bevor der symbolische erste Spatenstich vollzogen wurde, gab es noch eine Pressekonferenz, die über die Besonderheiten des Konzeptes berichtete. Die Idee wurde von drei Professoren der Uni geboren und wird auch weiterhin von ihnen betreut, so Roland Methling. „Im Grunde genommen wird die fertige Schule ein physikalisches Kabinett sein“, sagte der Bürgermeister. Solaranlagen, Photovoltaik und eine Windkraftanlage werden die Schule mit Energie versorgen. Kombiniert mit einer besonderen Dämmung und einer effizienten Bauweise lassen sich jährlich rund 53000 Euro an Energiekosten einsparen. Außerdem soll sogar noch überschüssiger Strom ins Netz gespeist werden. Bis 2013 soll der Umbau fertig sein und bis dahin ungefähr 7,7 Millionen Euro gekostet haben. Mit konzipiert hat das Projekt der Architekt und Diplomingenieur Martin Wollensak, der jetzt an der Hochschule in Wismar arbeitet. Er beschrieb dann auch Details des Umbaus. In den Sommerferien wurden schon die ersten Gebäude abgerissen und im nächsten Arbeitsschritt wird nun ein neues Grundschulgebäude gebaut. Dann wird in einem zweiten Schritt ein weiterer Neubau vorgenommen und zeitgleich wird in einem dritten Arbeitsabschnitt der bestehende Altbau generalsaniert. Der Schulumbau ist eins von nur drei PLUS-Energie-Projekten dieser Art in Deutschland und ist eine Investition in die Zukunft. Finanziert wird der Bau durch Mittel vom Bund und dem Land, 2,3 Millionen Euro übernimmt die Stadt Rostock selbst. Nach der Pressekonferenz ging es dann endlich ans Werk. Vor dem 1960 erbauten Gebäude, das eine Sanierung sichtbar nötig hat, warteten schon die Schüler. Schilder mit der Aufschrift „Der Anfang ist gemacht“ symbolisierten den Wunsch der Schüler, endlich in einer angemessenen Umgebung zu lernen. Neben Roland Methling nahmen noch Ulrich Buchta vom Landeswirtschaftsministerium und Markus Kratz als Vertreter des Bundes den Spaten in die Hand. Vom Jubel der Schüler begleitet schaufelten sie die erste Ladung Kies. Um schneller fertig zu werden, halfen dann auch die Grundschüler mit und sangen passend: „Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern gehen.“ Im anschließenden Gespräch verriet mir Schulleiterin Marianne Ehlert, dass sie sich sehr über den Baubeginn freue. Ungefähr 1000 Schüler werden in den neuen Gebäuden unterrichtet. Und damit die Schüler besser Bescheid wissen, wird es eine eigene Energielinie geben, die das Thema so in den Unterricht bringt. Unterstützt wird das Ganze durch Projekte, die sich mit dem bewussten Umgang mit Energie beschäftigen. Auf die Befürchtung, dass zu sehr auf ökonomische Aspekte geachtet werde, versicherte sie mir: „Meine Kinder werden keine kalten Füße haben.“
5. November 2010 | Weiterlesen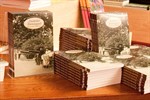
Rostocker Zorenappels Band 4
„Wir freuen uns, dass so viele da sind, trotz des schlechten Wetters. Auch wir hatten uns schon überlegt, ob wir überhaupt kommen“, scherzte Achim Schade vom Verlag Redieck & Schade bei der Premiere der neuesten Ausgabe des Rostocker Zorenappels. Veranstaltet wurde die Lesung in diesem Jahr in der Universitätsbuchhandlung Weiland. Eingebunden war die Buchpremiere in die mittlerweile 9. Rostocker Lichtwoche der Stadtwerke Rostock. Nachdem im letzten Jahr die Technik teilweise Probleme verursachte, wurde dieses Mal auf zusätzliche Multimedia Beiträge verzichtet, was der gut besuchten Veranstaltung aber keinen Abbruch tat. Musikalisch untermalt wurde sie von Christian „Jack“ Hänsel an der Gitarre, der Klassiker wie „Ruby Tuesday“ von den Rolling Stones oder „Homeward Bound“ von Simon & Garfunkel intonierte. Zählt man die beiden Sonderhefte mit, umfasst die Zorenappels-Reihe mittlerweile sechs Bücher, offiziell handelt es sich aber um den vierten Band der Stadt-Schreiber-Geschichten. Eine weitere Sonderausgabe soll bereits im Mai 2011 erscheinen. Darin wird es vornehmlich um Rostocker Katastrophen und Abenteuer gehen. Des Weiteren prüft der Verlag derzeit, inwieweit sich das Modell auf andere Städte in Mecklenburg übertragen lässt. Was erwartet den Leser nun aber bei der Lektüre des neuesten Zorenappels? Zunächst ein paar Zahlen: Über 30 Autoren haben 80 Beiträge verfasst, von denen es letztendlich 40 in diese Ausgabe geschafft haben. Insgesamt haben sich damit bislang 87 Autoren an der Reihe beteiligt. Inhaltlich fährt man zweigleisig. Zum Einen gibt es Beiträge, die erforschte Rostocker Geschichte, wissenschaftlich recherchiert, widergeben. Andererseits gibt es aber auch erlebte Geschichte zu entdecken, die einen subjektiven Blick auf vergangene Ereignisse liefert. Letzteres wird in Band 4 auch erstmals durch Lesermeinungen verstärkt. So schildern darin Leser Ereignisse, die in den vorherigen Bänden beschrieben wurden, die aber persönlich auf ganz andere Art und Weise erlebt wurden, als in besagtem Beitrag. Durch die Einbeziehung mehrerer Ansichten soll ein objektiveres Bild der Geschichte gezeichnet werden. Die Beiträge reichen von „250 Freimaurerei in Rostock“ über „Rostocker Pfingstmarkt in vergangenen Zeiten“ bis „Ein berühmter Gast: Richard Strauss“. Es gibt also wieder jede Menge über Rostock zu lernen und keine Angst, es handelt sich nicht um endlose Abhandlungen, sondern um kompakte ca. vier bis fünf Seiten lange Artikel, die entsprechend gut zu lesen sind. Diesen Eindruck hinterließen zumindest die während der Lesung vorgestellten Textauszüge. In der nächsten Woche wird es wie schon im Vorjahr von Donnerstag bis Samstag im Rostocker Hof Sondertische geben, an denen das Buch erworben und sicherlich auch der eine oder andere Autor angetroffen werden kann. Ansonsten ist das Buch natürlich auch in den Rostocker Buchhandlungen verfügbar.
4. November 2010 | Weiterlesen
„Lange Straße Abbey Road“- im Theater im Stadthafen
Kreischende Fans verfolgen vier junge Musiker auf Konzerten, auf Straßen, auf dem Bahnhof, überall. Mit diesen Bildern beschreibt der Film „A Hard Day’s Night“ von 1964 Szenen aus dem Alltag von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Star auf dem Höhepunkt der „Beatlemania“. Ein halbes Jahrhundert ist es nun schon her, dass sich die „vier netten Jungs aus Liverpool“ zu einer Rock’n’Roll Band zusammenfanden und in einem Hamburger Nachtklub zum ersten Mal als „The Beatles“ auftraten. In den darauffolgenden zehn Jahren setzten sie musikalische und kommerzielle Maßstäbe, die heute noch Gültigkeit haben. Weltweit begeistern sie seither über Generationen hinweg ihre Fans. Davon gibt es auch in Rostock eine ganze Reihe, wie bei der Uraufführung von „Lange Straße Abbey Road“ im Theater im Stadthafen am Montagabend deutlich wurde. 200 Gäste wollten im ausverkauften Theater die Rostocker Hommage an die Beatles sehen, an der schon im Vorfeld zahlreiche Akteure vom Landesverband für Populäre Musik und Kreativwirtschaft, der Hochschule für Musik und Theater, dem Institut für Neue Medien und das Rostocker Volkstheater mitwirkten. Inszeniert wurde die Show aus Musik, Schauspiel und Film unter der Leitung von Mark Auerbach und Wolfgang Schmiedt. Sie verlegten die Geschichte, die die Beatles im England der Swinging Sixties erlebt hatten, ins Jahr 2010 nach Rostock. Ein gelungener Kunstgriff nach dem „Was-wäre-wenn-Prinzip“, der in seiner Unglaublichkeit beim Publikum für einige Lacher sorgte. Gleich am Anfang wurden auf einem Split-Screen die Parallelen deutlich. Links lief der schwarz-weiße Originalfilm „A Hard Day’s Night“ mit den Beatles, rechts die farbige Rostocker Version mit den Plastic Wings. So heißt die fiktive Band aus „Lange Straße Abbey Road“, die von der Hansestadt aus die Musikwelt erobert. Die witzig-freche Art, wie die Musiker mit der überwältigen Aufmerksamkeit durch Fans und Medien umgehen, gleicht sich auf verblüffende Weise. Durch das Festhalten an visuellen Vorgaben bleibt der Transfer in die Gegenwart jedoch teilweise etwas inkonsequent (Würden hysterische Fans etwa heute wirklich noch CD-Läden stürmen?). Den Original-Vorgaben, der Musik, dem coolen schwarzen Rollkragen-Look kann man dann wohl doch nichts mehr hinzufügen. Das ist auch gut so für eine Beatles-Hommage. Sehr erfreulich war, dass die Songs der Beatles, die live auf der Bühne von sieben Musikern gespielt wurden, den originalen treu blieben und trotzdem auf interessante und angenehme Weise eigenständig waren. Dafür sorgte nicht zuletzt auch die eindringliche Stimme der Sängerin Anna Janine Wöhrlin. Der Enthusiasmus und die Spielfreude der Musiker (wen wundert’s bei der Musik) übertrug sich auch auf das Publikum. Viele wären bestimmt gern zum Tanzen aufgesprungen, wenn da nicht die Theaterstühle gewesen wären. Die Handlung des Theaterstückes blieb ebenfalls eng an der Geschichte der „Fab Four“ angelehnt. „To the Toppermost of the Poppermost“ wird ihr Weg von den jugendlich charmanten Jungs aus Liverpool, über die kreativen Musiker, die mit einer Reihe innovativer Elemente die Popmusik bereicherten, ihren Drogentrips, Größenwahn, bis zur ernüchternden Trennung nachgezeichnet. Johanna, Paul, Gerda und Richard dargestellt von Sandra-Uma Schmitz, Andreas Köhler, Maria Radomski und Tim Ehlert entsprachen den legendär gewordenen Charakteren der britischen Band John, Paul, George und Ringo. Die unkonventionelle, reflektierte Johanna in sportlich-legerer Kleidung und der Schwiegermutterliebling Paul in bürgerlich, kariertem Anzug bilden das dominierende kreative Duo innerhalb der Plastic Wings. Das Publikum wird Zeuge wie aus einer einfachen Melodie auf „Scrambled Eggs“ das weltbekannte „Yesterday“ entsteht. Die zarte Gerda, mit romantischen Blümchen geschmückt, hat es da schwer, ihre eigenen Ideen einzubringen und auch der ansonsten so heiter wirkende Richard vermisst die alten Zeiten mit seinen Freunden. Dissonanzen machen sich in der Band bemerkbar. Größenwahnsinnige Statements wie „Wir sind bekannter als Jesus“ lassen die Zustimmung in der Öffentlichkeit sinken. Johanna konzentriert sich mehr und mehr auf ihre Beziehung zu einer asiatischen Schönheit (Hsin-Han Chang), die an Yoko Ono erinnert. Ihr gemeinsam vorgetragener Song „Strawberry Fields Forever“ stellte einen der vielen Höhepunkte in „Lange Straße Abbey Road“ dar und sorgte für Gänsehaut. Nicht ganz unschuldig an der Entwicklung der Plastic Wings dürfte auch ihr Manager (Ulrich K. Mühe) sein. In schillernden Auftritten treibt er die Bandmitglieder an und führt sie immer wieder auf teuflische Weise in Versuchung. Da helfen auch Beschwörungsformeln wie „We Can Work It Out“ oder „Let It Be“ nicht weiter. Am Ende gehen die Plastic Wings getrennte Wege. Und mit welchem Beatles-Stück könnte man diese Trennung passender untermalen als mit …? Stopp, das wird natürlich nicht verraten – die Auflösung gibt es am 5.November, 2., 3. und 4. Dezember im Theater im Stadthafen.
3. November 2010 | Weiterlesen
Eröffnung der 9. Rostocker Lichtwoche 2010
Am Sonntag wurde die Uhr eine Stunde zurückgestellt und dadurch die dunkle Jahreszeit eingeläutet. Nun geht die Sonne schon gegen 17 Uhr unter und taucht die Stadt in Finsternis. Zum Glück gibt es wie in jedem Jahr nach der Zeitumstellung die Rostocker Lichtwoche, die dabei helfen soll, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Zentrale Anlaufstellen sind, wie schon in den letzten Jahren, das Zelt auf dem Uniplatz und das Haus der Stadtwerke Rostock AG, die Ausrichter der Veranstaltung sind. Die Eröffnung hat schon einmal einen guten Einblick gegeben, was uns in dieser Woche alles erwartet. So kündigte Oliver Brünnich, Vorstand der Stadtwerke, an, dass es in diesem Jahr wieder viel Altbekanntes geben wird, wie die Lasershow und das Feuerwerk zum Abschluss. Aber auch einiges Neues findet sich im Programm, wie die Reihe „Kunst auf der Treppe“, auf die er sich schon besonders freue. Nach der kurzen Ansprache gab es neben dem Zelt eine kleine Feuerwerksshow als Einstimmung, die mit einer brennenden Neun abschloss. Die erste Lichtwoche fand übrigens schon 1928 statt. Damals haben die Unternehmer einen Weg gesucht, die neu in der Stadt etablierte Elektrizität zu präsentieren. 2003 folgte dann erst die zweite Lichtwoche, die im Zusammenarbeit von Studenten und den Stadtwerken wiederbelebt wurde. Um sich an dem doch recht kalten Abend aufzuwärmen, konnte ein Glühwein oder ein Kinderpunsch getrunken werden, bevor der erste Laternenwärterrundgang startete. Einer der Stadtführer ist Willy Holzt. Er ist schon seit vielen Jahren Stadtführer und gerade die Rundgänge mit der Laterne sind ein großer Publikumsmagnet in der Lichtwoche. Da erfährt man im Schein der Nachtlampe etwa, dass vor 200 Jahren ein Erleuchtungsverein in der Stadt gegründet wurde und es heute noch sieben echte Gaslaternen in der Stadt gibt. Als der Rundgang vorbei war, begann auch schon die nächste Show. Vor dem Zelt der Stadtwerke hatte Gaukler und Feuerkünstler Arne Feuerschlund seinen Platz eingenommen. Umringt von einer großen Menschenmenge spielte er nicht nur mit dem Feuer, sondern auch mit dem Publikum. Mit viel Witz konnte er vor allem die Kinder auf seine Seite bringen. Trotzdem war natürlich die Feuershow das Highlight. So vollführte er einen Feuertanz, ließ Fackeln springen und jonglierte sogar mit zwei Fackeln und einem Apfel gleichzeitig, den er auch noch währenddessen aß. Ziemlich beeindruckend. Weiter ging es danach durch die illuminierte Kröpeliner Straße zum Haus der Stadtwerke. Lichttore, beleuchtete Würfel und Figuren, sowie Neonbäume bringen Licht ins Dunkel. Auch das in unterschiedlichen Farben angestrahlte Hauptgebäude der Universität sieht sehr gut aus – Schade nur, dass man durch die Bauarbeiten nicht hineingehen kann, um den Uniplatz von oben zu sehen. Im Kundencenter findet in diesem Jahr zum ersten Mal die Reihe „Kunst auf der Treppe“ statt. Bis Donnerstag gibt es jeden Tag ein Konzert mit Studenten der Hochschule für Musik und Theater, im Rahmen der Young Academy Rostock, dem internationalen Zentrum für musikalisch Hochbegabte. Den Anfang machten am Montag die Schwestern Sornitza und Petia Patchinova. Sie spielten auf den Violinen Werke wie Mozarts „Zauberflöte“ oder Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, was vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurde. Als Abschluss noch ein Blick auf die Ausstellung von Bert Preikschat und, bei einem Glühwein, noch ein Gespräch mit dem Abteilungsleiter für Privatkunden, Norbert Olschewski. Der verriet mir, dass ungefähr 5700 Lichtelemente die Stadt zum Leuchten bringen. „Wir machen die Lichtwoche nicht aus einem künstlerischen Anspruch heraus, sondern um ein wenig Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen. Dafür haben wir um die 20 Helfer im Einsatz, alles echte Stadtwerkler, damit die Gäste auch kompetente Ansprechpartner haben.“ Jeden Abend wird der Lichtpfad übrigens kontrolliert, es kann ja doch mal eine Lampe ausfallen. Noch bis zum Samstag ist die Stadt in Licht getaucht. Das Programm der 9. Rostocker Lichtwoche kann man hier finden. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Angebote wahrzunehmen, bevor es ab nächster Woche wieder richtig düster wird.
2. November 2010 | Weiterlesen
Lampionfest im Rostocker Zoo 2010
Wenn über dem Rostocker Zoo die Sterne und unten die Laternen der Kinder leuchten – dann ist Lampionfest. Schon am Samstagnachmittag begannen die Vorbereitungen: Laternen wurden gebastelt und Zauberstäbe in Schwung gebracht. In der Abenddämmerung begrüßte dann Leierkastenmann Charly die Zoobesucher am Einlass mit stimmungsvollen Laternenliedern und anderen Volksweisen. Nachdem auch die Fischotter ihr Abendessen und die Seebären ihren Gute-Nacht-Kuss von ihrem Tierpfleger und Fußballcoach Lars Purbst bekommen hatten, war es dunkel genug für den Zauberwald. Rätselhafte Gesellen, so heißt es, sollen hier ihr Unwesen treiben. Aber „wie gut, dass wir die große Hexe getroffen haben“, machte die sechsjährige Melodie ihrer Familie Mut. Die große Hexe bewachte das Tor zum Zauberwald und verteilte an alle, die tapfer in die ungewisse Dunkelheit schritten, Feenstaub, „damit man heil durch den Zauberwald kommt“. Dort war es ganz schön finster. Aber zum Glück waren die meisten Kinder mit bunten Lampions ausgestattet, die den Weg beleuchteten. So konnten sie mühelos dem kleinen, mit einer Lichterkette geschmückten Zoo-Auto folgen, aus dem lustige Kinder-Musik erschallte. Eine fröhliche Karawane zog durch den Zoo. Einige Väter oder andere männliche Vertrauenspersonen hatten die kleinen, schon etwas müden Laternenkinder auf ihre Schultern gehoben, wo sie wie auf einem Elefanten unter den nächtlichen Bäumen schaukelten. Kinderwagen waren mit Lampions oder Neonleuchtmittel geschmückt. Passend zu Halloween hatten sich kleine Hexen, Feen und Teufel in die Lampiongesellschaft eingereiht und zogen an den fast unsichtbaren Tiergehegen vorbei. Ob sich dort jemand in der Dunkelheit versteckte und heimlich das bunte Treiben beobachtete? Wer ganz still war, konnte vielleicht sogar ein leises Schnarchen hören, aber so still war natürlich keiner. Die ganze Tour war dafür viel zu aufregend. Das meinten zumindest Mia und Emma. Die beiden Sechsjährigen hatten sich als Hexe und Teufel verkleidet und fanden es toll, nachts mit einer Laterne die Eisbären zu besuchen. Auch die vierjährige Johanna hatte sich ein Teufelskostüm angezogen. In der einen Hand trug sie die Teufelsgabel und in der anderen ihren Lampion, den sie mit ihrer Mutter selbst gebastelt hatte. Diese erzählt, dass die Familie oft den Zoo besucht, es nachts aber etwas Besonderes sei. Nach einem langen Rundgang durch den nächtlichen Zoo endete der Lampionumzug auf dem Festplatz. Hier sorgte ein großes Lagerfeuer für behagliche Stimmung. Bei einem Imbiss konnten Hunger und Durst gestillt werden und Arne Feuerschlund zeigte zum Ausklang des Abends eine witzige und waghalsige Jonglier- und Feuershow.
1. November 2010 | Weiterlesen
Iris Thürmer – 20 Arten zu vergessen
Am Samstag kamen nicht nur Kulturfreunde bei der Langen Nacht der Museen auf ihre Kosten. Auch Kunstbegeisterte in ganz Mecklenburg-Vorpommern konnten den gesamten Tag über Angebote im Rahmen des Tages der zeitgenössischen Kunst „Kunst Heute“ wahrnehmen. Ein besonderes Highlight war die Eröffnung der Ausstellung von Iris Thürmer in der Galerie wolkenbank mit dem Titel „20 Arten zu vergessen“. Die wolkenbank ist nicht nur Galerie, sondern versteht sich gleichzeitig als Agentur und Planungsbüro. „Wir wollen besonders Künstler aus unserem Land fördern“, sagt Galerist und Geschäftsführer Holger Stark. Acht Ausstellungen gibt es jährlich in dem Haus in der Wollenweberstraße zu sehen, welches im Dezember letzten Jahres gegründet wurde. „In diesem Jahr wird es zur Weihnachtszeit wieder eine Gruppenausstellung mit lockerer Kunst geben“, schaut Stark schon einmal voraus. Im Gegensatz dazu zeichnen sich die Werke von Iris Thürmer durch eine große Intensität, Tiefe und Dichte aus. Die Künstlerin aus Wolthof arbeitet mit vielschichtigen Bildern, die auch häufig durch Texte geprägt sind. Die Bilder, die in dieser Ausstellung zusammengetragen sind, unterscheiden sich jedoch ein wenig von ihren sonstigen Arbeiten. So gibt es mehr monochrome, leuchtende Farbflächen, die Dichte wurde zugunsten von einer luftigen und schwingenden Wirkung zurückgefahren. Nur in einem Bild hat Iris Thürmer Text verarbeitet. Es trägt den Titel: „Das muss doch nicht sein!“ und ist auf Baumwollgewebe gemalt, wie die meisten Bilder der Künstlerin. Sie verriet mir, dass der Text doch sehr dominant im Gesamtgefüge steht und so am ‚zur Ruhe kommen‘ hindert. „Ich arbeite sehr intuitiv und kann daher nicht genau beschreiben, was es mit diesem Satz auf sich hat.“ Man kann das Bild als Angebot sehen, sich selbst Gedanken zu machen. Jeder hat schon einmal diesen Satz gehört und kann die Farben und Wirkungen anders assoziieren. Ein amüsantes Detail am Rande ist, dass nur 19 Bilder ausgestellt sind, obwohl der Titel „20 Arten zu vergessen“ lautet. Darauf angesprochen, sagt Iris Thürmer lächelnd: „Wir haben das 20. Bild einfach vergessen.“ Auch darin kann man vielleicht einen bewussten Prozess sehen, der zu den Arbeiten der Künstlerin passt. Durch das Übermalen und die verschiedenen Schichten kommen immer wieder Sachen durch, die man vielleicht schon vergessen hat. „Vergessen ist ein heilsamer Prozess. Dadurch, dass man neue Informationen aufnimmt, werden alte überschrieben“, so Thürmer. „Die Bilder sind ein Augenschmaus für mich“ – mit diesen Worten eröffnete Holger Stark die Ausstellung. Zum ersten Mal gibt es auch einen ausstellungsbegleitenden Katalog, der in der wolkenbank erworben werden kann. Von Mittwoch bis Samstag, 14 bis 19 Uhr, können sich Kunstinteressierte die Bilder anschauen.
1. November 2010 | Weiterlesen
Pinocchio – Abenteuer für Kinder im Volkstheater Rostock
Eines Tages ein richtiger Junge zu sein, davon träumt Pinocchio. Der alte Spielzeugmacher Gepetto hatte die Marionette aus einem Stück Holz geschnitzt. Eine Fee erweckte sie eines Nachts zum Leben. „Erweise dich als tapfer, aufrichtig und selbstlos“, gab sie Pinocchio mit auf den Weg. „Dann wirst du eines Tages ein richtiger Junge sein.“ Leichter gesagt, als getan. Das konnten zumindest die Besucher des Volkstheaters am Sonntag bei der Premiere von „Pinocchio“ erleben. Für Kinder ab sechs Jahren hat der Regisseur und Choreograf Bronislav Roznos die Geschichte von Carlo Collodi mit seinem Tanztheater inszeniert. Die Handlung des Stückes orientiert sich an dem Filmklassiker von Walt Disney aus dem Jahre 1940. Hier wird Pinocchio, dargestellt von Enkhzorig Narmandakh, die Grille Jiminy zur Seite gestellt. Als sein Gewissen soll sie dafür sorgen, dass die Marionette auf dem Pfad der Tugend bleibt und lernt zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Doch viele Versuchungen und zwielichtige Gestalten machen es der sympathischen Grille, getanzt von Josef Dvorák, schwer. Schon bald schmeißt Pinocchio die Schule, läuft davon und schließt sich der Theatergruppe von Stromboli an. Unterwegs trifft er auf einen Fuchs und einen Kater, die es auf sein Geld abgesehen haben. Er landet im Gefängnis, und wenn er lügt, wird seine Nase immer länger. „Eine Lüge wächst immer weiter, bis sie so groß ist, wie die Nase in deinem Gesicht“, warnt ihn die weise Fee. Immer wieder schwebt sie von oben herab, um Pinocchio aus der Patsche zu helfen. Natalie Brockmann wurde für ihre Rolle mit einem zauberhaften, leuchtenden Kleid ausgestattet. Auch die anderen Kostüme und das Bühnenbild wurden von Robert Schrag farbenfroh gestaltet. Besonders beeindruckend ist eine Unterwasserszene. Fantasievolle Meeresbewohner in vielfältigen Formen und Farben begegnen Pinocchio auf der Suche nach seinem Vater Gepetto (Clemens Soenen). Dieser hatte sich ebenfalls auf den Weg gemacht, um seinen ausgerissenen Sohn zu finden. Dabei wurde er von einem riesigen Wal verschluckt. Die spannenden Abenteuer der hölzernen Marionette Pinocchio werden zur Musik von Michael Giacchino aus dem Film „Ratatouille“ getanzt. Die klare Körpersprache der Darsteller und die vom Band eingespielten Stimmen einiger Figuren erzählen die Geschichte für kleine und große Zuschauer auf verständliche Weise und lassen genügend Spielraum für die eigene Fantasie. Das Premierenpublikum belohnte die Akteure für ihre Darstellung zwischendurch und am Schluss mit kräftigem Beifall. „Ich will auch ein Theater in meinem Haus“, rief die neunjährige Paula begeistert und auch etwas traurig nach der Aufführung. Ein kleiner Trost waren für sie die Tänzer, die mit ihren Kostümen nach der Vorstellung im Foyer großzügig Bonbons und Autogramme an ihre jungen Fans verteilten. Ob es Pinocchio gelingt, Gepetto zu retten und ein richtiger Junge zu werden, können sich die Besucher des Volkstheaters bei den nächsten Vorführungen am 4. November sowie am 4., 8., 18. und 29. Dezember anschauen. Fotos 1 bis 3: Dorit Gätjen, VTR
1. November 2010 | Weiterlesen
20. Landesfilmfest Mecklenburg-Vorpommern 2010
Bärbel Dudeck schwelgt in Erinnerungen, wenn sie zurückdenkt an die Anfänge vor 20 Jahren. „In den ersten drei, vier Jahren waren es die Amateurfilmer aus DDR-Zeiten, die das Landesfilmfest zum Leben erweckten.“ Aus Rostock, Güstrow, Greifswald und Grevesmühlen kamen die begeisterten Hobbyfilmer, erinnert sich die Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Filmautoren (BDFA) Mecklenburg-Vorpommern. Ab 1994 entdeckte dann auch die „junge Garde um Filmemacher wie Matthias Spehr“ das Festival für sich. 20 Landesfilmfeste hat Bärbel Dudeck mit ihrem Team vom Hanse Filmstudio Rostock seit 1991 auf die Beine gestellt. „Viel Arbeit, alles ehrenamtlich in der Freizeit, stecke in der Vorbereitung, aber es lohnt sich“, bekräftigt die Organisatorin. Nur das mehr als „knappe Budget, das gerade so für die Unkosten der Juroren“ reiche, macht ihr etwas Sorgen. Wünschen würde sich Dudeck auch wieder etwas mehr Nachwuchs für das Hanse Filmstudio, aber die Zeit sei sehr schnelllebig geworden und „die wenigen jüngeren Mitglieder sind beruflich meist ziemlich eingespannt.“ Auf die schönsten Erinnerungen der letzten zwei Jahrzehnte angesprochen, strahlt die engagierte Amateurfilmerin. 20 Jahre Landesfilmfest bedeuten für sie vor allem eins: Hunderte toller Beiträge. Und so gibt es auch erst mal eine kleine Feier mit den Weggefährten der letzten 20 Jahre. Anschließend, so verrät Bärbel Dudeck, wird am kommenden Freitag ab 19:30 Uhr ein Potpourri von Wettbewerbsfilmen aus der 20-jährigen Geschichte gezeigt. Ein kleiner Geheimtipp, noch vor dem eigentlichen Start des Filmfests, erklärt sie schmunzelnd. Was gezeigt wird, möchte sie eigentlich noch nicht verraten, gibt dann aber doch ein paar Beiträge preis. „Stumme Zeugen“ (1991) von Rolf Spieker zeigt Bilder aus der zerfallenen Rostocker Altstadt zur Wendezeit. Ein Film, der sicher viele Rostocker interessieren dürfte. „Ende oder Anfang“, einer von Dudecks eigenen Filmen, stamme ebenfalls aus der Wendezeit und zeige auch historische Aufnahmen der Grenzanlagen in Schlutup. Die junge Generation würde heute natürlich eher actionreiche Spielfilme drehen, aber „Dokumentarfilme überleben Jahrzehnte“. Ganz anders sei „Der Test“ aus dem Jahre 1994. Ein Vater geht mit seiner 16-jährigen Tochter zum I.Q.-Test. Ergebnis? Zu klug! Folge? Ermordung durch das System. „Welche Bestattung wünschen Sie sich für Ihre Tochter?“ Schon ein etwas makaberer Film, so Dudeck, aber er „entspricht dem damaligen Zeitgeist.“ Doch zurück zum aktuellen Festivalprogramm, das am Samstag, dem 6. November um 9 Uhr offiziell eröffnet wird. Insgesamt 42 Beiträge kämpfen in diesem Jahr um den Titel „Bester Film des Festivals“ und damit um die Medaille des BDFA. Wichtiger dürfte für viele der Teilnehmer aber fast noch die mögliche Weiterleitung zu den Bundesfilmwettbewerben sein. Begann doch beim Landeswettbewerb schon für einige Filmemacher der Weg zu internationalen Wettkämpfen oder gar der Einstieg in die Profikarriere. Zwei Sonderpreise stehen in diesem Jahr ebenfalls zur Vergabe an. Den „Kameramann“, gestiftet vom Offenen Kanal ROK-TV, gibt es für die beste Filmidee. Den Filmemachern, die besonders viel Arbeit in die Vorbereitung investiert haben, winkt die „Silberne Hand“ – ein Wanderpreis, der von Nane und Kris gesponsort wurde. Ob Trick- und Animationsfilm, Drama, Spielfilm, Musikvideo, Experimental- und Dokumentarfilm oder Reportage – es gibt wohl kein Genre, das auf dem Treffen der Filmemacher nicht vertreten ist. Und auch das Altersspektrum der Akteure ist in diesem Jahr wieder breit gefächert, wohl auch eine Besonderheit des Landesfilmfestes. Mit dem Trickfilm „Elias und Wölkchen aus dem Ei“ gehen die jüngsten Teilnehmer an den Start, die 5- und 6-Jährigen der Vorschulgruppe des Evangelischen Kindergartens Rostock. Mit 78 Jahren der älteste Teilnehmer ist Wolfgang Brietzke aus Rostock, der mit einem Dokumentarfilm über seine gefiederten Wintergäste antritt. Eine Neuerung beim diesjährigen Filmfest ist die Aufteilung der einzelnen Filmblöcke, erläutert Bärbel Dudeck: „Wir wollten die einzelnen Altersgruppen etwas mehr trennen, im Sinne der Teilnehmer und der Zuschauer.“ So gibt es am Samstag jeweils einen eigenen Block für die jüngsten, die jüngeren sowie die jungen Filmemacher. Und auch die „filmenden Senioren“ haben zwei eigene Blöcke bekommen – am Sonntagvormittag. Neu ist in diesem Jahr auch der Veranstaltungsort. In Kooperation mit der Rostocker Kulturwoche findet das Landesfilmfest 2010 im Peter-Weiss-Haus statt. Ausreichend Platz für die hoffentlich zahlreich erscheinenden Zuschauer ist somit vorhanden.
31. Oktober 2010 | Weiterlesen
Lange Nacht der Museen 2010 in Rostock
18 Uhr. Gespanntes Warten. Das Wetter ist angenehm, kein Regen, nicht zu kalt, ein leichtes Lüftchen weht. Es dämmert. Dann erklingt Musik, Rammstein. Feuer frei. Und ein Flammenkegel erhellt das Deck des Traditionsschiffs. Herzlich willkommen zur Langen Nacht der Museen 2010. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr ein offizielles Auftaktevent, nämlich eine Feuershow mit dem Künstler „The Fire Drake“. Nachdem im letzten Jahr nicht so viele Gäste wie erhofft den Weg zum Museumsschiff genommen haben, wurde der Standortnachteil in diesem Jahr förmlich weggebrannt. Etwa 300 Menschen wollten wissen, ob die Feuershow das Schiff in Brand setzt. Zum Glück ist dies nicht passiert, auch wenn Feuer gespuckt wurde, brennende Kugeln durch die Luft sausten und Funken sprühten. Im Anschluss daran führte mich Museumsleiter Dr. Peter Danker-Carstensen durch das Schiff und zeigte mir, was sie in diesem Jahr alles für die Gäste vorbereitet hatten. „Es ist mir eine Ehre, dass wir zu unserem 40. Jubiläum die Auftaktveranstaltung bestreiten dürfen.“ Viele besondere Angebote hat das Museumsteam zusammengestellt. So wurden Filme über das Schiff gezeigt, es gab Führungen, man konnte funken und morsen und das traditionelle Handwerk wurde gezeigt. Alexander Kiencke, traditioneller Holzschiffbauer und Betreuer der museumspädagogischen Angebote, hatte dazu auch eine Reeperbahn aufgebaut. Dort wurden jedoch keine leichten Mädchen gezeigt, sondern wie man Seile herstellt. Drei dünne Hanfschnüre werden zu einem dickeren Seil gedreht. Mit diesen Seilen konnten die Kinder dann auch gleich alte Seemannsknoten üben. Ich hätte sicherlich noch länger auf dem Schiff bleiben können, doch hatten noch 14 andere Rostocker Einrichtungen ihre Pforten geöffnet. Also rein in den von der RSAG gesponsorten Shuttlebus und ab zur nächsten Station auf meiner nächtlichen Museumstour, dem Depot 12. Die Interessengruppe Rostocker Nahverkehrsfreunde hat in Zusammenarbeit mit der RSAG das alte Straßenbahndepot in Marienehe zu einem Museum umgewandelt. Der Vorsitzende der Interessengruppe, Ulrich Rohde, führte die Gäste durch die Räumlichkeiten und zeigte die alten Fahrzeuge. „Bis auf zwei Ausstellungsstücke sind alle Busse und Bahnen noch fahrtüchtig. Sogar die älteste Bahn, der Wismarer Triebwagen aus dem Jahr 1926, ist noch einsatzbereit.“ Bevor es zur nächsten Station weiterging, stärkte ich mich noch etwas, denn das konnte man im Depot 12 nicht nur günstig, sondern auch in einer ganz besonderen Atmosphäre. Im Triebwagen mit der Nummer 46 wurden Getränke ausgeschenkt und Würstchen verkauft. Nebenbei konnte man stilecht auf den alten Sitzen Platz nehmen und auf einem Bildschirm Filme über die historischen Bahnen sehen. Wusstet ihr, dass die RSAG im Jahre 1881 gegründet wurde und eine Einzelfahrt damals noch 10 Pfennig gekostet hat? Mit diesem Wissen ging es wieder in den Shuttlebus, der im Preis der Karte schon mit inbegriffen war, und ab zum nächsten Ausstellungsort, dem Heinrich Schliemann-Institut für Altertumswissenschaften. Dieses zeigte eine Sammlung von Skulpturen der Griechen und Römer. Eine Premiere, denn die eigentliche Ausstellungseröffnung findet erst im nächsten Jahr statt, wie mir Kustodin Dr. Jutta Fischer berichtete. „Es ist vor allem eine Lehrsammlung. Dadurch, dass alles Abgüsse sind, kann man damit im Rahmen des Studiums auch experimentieren.“ Viele der Ausstellungsstücke sind auch eine Dauerleihgabe der Universität Greifswald, da das dortige Institut für Altertumswissenschaft geschlossen wurde. Inzwischen war es 22 Uhr und noch immer hatte ich die Innenstadt vor mir. Eigentlich wollte ich direkt in das Kulturhistorische Museum, entschied mich dann aber spontan für einen kurzen Abstecher in die Zoologische Sammlung der Universität. Und das war eine gute Entscheidung, denn dort gab es unglaublich viel zu sehen. Zum einem wurde die Sonderausstellung mit dem Thema „Schönheit und Artenvielfalt im Tierreich“ präsentiert. Es gibt ungefähr 15 bis 20 Millionen Tierarten auf der Erde. Von 50.000 gibt es in der Zoologischen Sammlung Präparate. In der Sonderausstellung geht es vor allem um die Frage, was Schönheit ist und welche Funktion sie im Tierreich hat. Doch nicht nur Präparate wurden gezeigt. Einige Studenten haben mit einem Brutapparat Hühnerküken ausgebrütet. Und die Überraschung war schon groß, dass diese nicht nur gelb sind, sondern auch schwarz und braun. Der Direktor des Instituts für Biowissenschaften, Prof. Dr. Stefan Richter, war hocherfreut über die vielen Besucher. „Es wäre nur noch besser, wenn die Leute nicht nur zur Langen Nacht der Museen kämen, sondern auch an normalen Tagen.“ Ich denke, das werde ich demnächst auch noch mal tun, denn obwohl ich mir längst nicht alles angeschaut habe, musste ich doch weiter zu meiner letzten Station, dem Kulturhistorischen Museum. Dort war nicht nur die Sammlung geöffnet, sondern es gab den ganzen Abend über Vorträge. Als ich um 23 Uhr ankam, sprach Dr. Steffen Stuth, der Museumsleiter, gerade über gekrönte Häupter auf Metall. Es ging um Münzen und die Geschichten, die hinter den Motiven stehen. So bekam ich sogar zum Abschluss des Abends noch einen Vortrag über die Münzgeschichte, begonnen bei Kaiser Karl. Beendet wurde der Abend traditionell mit einem Konzert in der Universitätskirche. Unter dem Motto Nach(t)klänge präsentierten Vladimir Sedlak am Fagott, Melina Paetzold an der Klarinette und Stephanie Treichel an der Oboe Werke von Bach, Mozart und Ibert. Die Studenten der Hochschule für Musik und Theater setzten damit einen gelungen Schlusspunkt, der durch die fantastische Akustik der Kirche noch verstärkt wurde. Einige Gäste hatten die Augen geschlossen. Ob sie nur die Musik mehr auf sich wirken lassen wollten oder aber so erschöpft von der langen Nacht waren, kann ich nicht beurteilen. Pünktlich um Mitternacht war das Konzert vorbei. Und auch, wenn noch einige Standorte geöffnet hatten, entschied ich mich den Heimweg anzutreten. Sechs Stunden Kultur haben ganz schön geschlaucht, aber auch sehr viel Spaß gemacht. Es war eine gute Organisation, wirklich jeder, mit dem ich gesprochen habe, war freundlich und hilfsbereit und auch die Gäste waren interessiert und entspannt. Die angestrebte Zahl von 4.000 Besuchern dürfte mindestens erreicht worden sein und somit kann die fünfte Lange Nacht der Museen wieder als voller Erfolg verbucht werden.
31. Oktober 2010 | Weiterlesen
23. Rostocker Kulturwoche an der Uni Rostock
Wenn junge Leute trommelnd durch Rostocks Zentrum ziehen, ist das Protest oder Kultur. Glückliche Hansa-Fans kämen natürlich auch infrage, besonders heute, wo der FC Hansa nach einem 2:1-Sieg über Saarbrücken die Tabellenspitze erobert hat. Dass heute Kultur das Thema in der Kröpeliner Straße war, konnte man weder übersehen noch überhören. Mit heißen Samba-Rhythmen warb die Rostocker Percussionband Movimento zusammen mit Vertretern des Kulturreferates des AStA der Uni Rostock für die 23. Rostocker Kulturwoche, die am kommenden Donnerstag startet. Bis zum 14. November wird auch in diesem Herbst wieder ein buntes kulturelles Programm geboten, bei dem für jeden etwas dabei sein dürfte. Höhepunkte herauszugreifen, fällt schwer. Fast schon zum Pflichtprogramm dürften der Poetry Slam (8. November, 20 Uhr im Ursprung) sowie das Studentische Kurzfilmfestival „Golden Toaster“ (10. November, 19 und 21 Uhr im LiWu) gehören. Kunst konzentriert gibt es am Samstag, dem 6. November ab 21 Uhr in der Alten Gerberei. Film, Musik, Theater und bildende Kunst vereinen sich hier zum Kunstkonzentrat. Nachdem die historische Schmiede in der Wollenweberstraße der östlichen Altstadt im September und Oktober 20 Kunstschaffenden der Region als „Galerie auf Zeit“ gedient hat, werden an diesem Tag noch einmal Werke einiger Künstler in der Alten Gerberei zu sehen sein. Wer etwas für Poesie und gute handgemachte Musik übrig hat, sollte sich den 12. November dick im Kalender anstreichen. Um 20 Uhr ist im Moya der Club der toten Dichter zu Gast. Nach Heinrich Heine und Wilhelm Busch vertont Reinhardt Repke im aktuellen Programm „Eines Wunders Melodie“ Texte von Rainer Maria Rilkes. Unterstützung bekommt er dabei von Katharina Franck, der unverwechselbaren Stimme der Rainbirds. 1999 aus der Taufe gehoben, ist die Rostocker Kulturwoche für ihren Projektleiter Daniel Karstädt inzwischen zur Herzensangelegenheit geworden. Im nächsten Jahr steht mit der 25. Auflage der Veranstaltung ein rundes Jubiläum an. Dürfen wir uns darauf noch freuen oder steht die Rostocker Kulturwoche auf der Kippe? Angesprochen auf die immer wieder aufkommenden Gerüchte, kann Karstädt nur mit dem Kopf schütteln: „Wirtschaftliches Denken prallt da leider oft auf künstlerisches – das sind zwei Welten.“ Bisher konnten sich die Befürworter der Kultur immer durchsetzen, zeigt sich der Erfinder der Kulturwoche verhalten optimistisch, auch wenn der Enthusiasmus bei einigen Studentenvertretern nicht mehr so groß sei wie früher. Dass es überhaupt eine 23. Kulturwoche gibt, ist aber vor allem der guten Resonanz zu verdanken, nicht nur bei den Studenten. „Wir haben eine Auslastung zwischen 70 und 90 Prozent, davon können andere Veranstalter nur träumen.“ Mehr als 2000 Besucher im Herbst und – einschließlich des Campuserwachens – rund 7000 Gäste im Frühjahr sprechen eine deutliche Sprache. Vielleicht sollten AStA und StuRa dieses Potenzial einfach nutzen, um aus ihrem eigenen Schatten und wieder mehr in das Bewusstsein der Studentenschaft zu treten. Karten für die 23. Rostocker Kulturwoche gibt es im AStA-Büro, beim Pressezentrum sowie bei der MV-Ticketbox.
30. Oktober 2010 | Weiterlesen
Das Netzwerk Hanse: Globalisierung im Mittelalter
Globalisierung – ein Schlagwort, das Assoziationen weckt, vermutlich bei jedem ganz unterschiedliche. Der eine mag an Mc Donald’s denken, an Coca Cola, Siemens oder einen der vielen anderen Global Player. Vielleicht kommen einem auch die Wirtschaftskrise und die internationalen Finanzmärkte in den Sinn oder man denkt an den Klimawandel und die vielen Probleme, die die Ungleichverteilung globaler Ressourcen mit sich bringt. Wer aber würde bei Globalisierung schon spontan ans Mittelalter denken? Und doch gab es im Mittelalter bereits das, wovon viele Politiker heute noch träumen: einen zusammenhängenden, globalen Wirtschaftsraum rund um die Ostsee. Im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung „Globalisierung“ des Wissenschaftsverbundes Um-Welt beleuchtete Dr. Steffen Stuth vom Kulturhistorischen Museum Rostock am Donnerstag das Netzwerk der Hanse. „Der Mensch konzentrierte sich auf seine Stadt, der Mensch konzentrierte sich auf sein Dorf“, veranschaulichte Stuth die vorherrschende Situation im Mittelalter. Mit mehr als 30 Einwohnern war ein Dorf schon groß, ebenso Städte mit mehr als zwei- oder dreitausend Bewohnern. Nicht gerade Fakten, die dafür sprechen, dass wir uns im Mittelalter in einem Zeitraum der Globalisierung bewegen. „Aber dennoch“, so Stuth, „ist gerade die Hanse, ist das Netzwerk der Hanse ein Ausdruck beginnender Globalisierung.“ Eine neue Erkenntnis, die erst in den letzten Jahren der Hanse-Forschung gewachsen sei. Nationalstaatliche und sprachliche Grenzen, wie wir sie heute im Ostseeraum haben, gab es im Mittelalter nicht. Der Raum war damals viel stärker vereinigt. Aber was war die Hanse überhaupt? Keineswegs ein föderalistisches System, wie Deutschland oder Nordamerika heute. Die Hanse war eher ein loser Städtebund, so Stuth: „Man gehörte dazu, wenn man sich zugehörig fühlte und man schied aus, wenn man keinen Erfolg mehr mit der Mitgliedschaft in diesem Bündnis verbinden konnte.“ Und doch gibt es erstaunlich viele Gemeinsamkeiten in den Städten der Hanse. Fast überall finden sich ähnliche Strukturen von Stadtgestaltung, Sprache, Recht und Kultur. All das über ein Gebiet, das von London bis Nowgorod, von Bergen und Gotland bis in den süddeutschen Raum reicht. Für Stuth durchaus Indizien dafür, dass es eben nicht einzelne Städte gewesen sind, sondern Städte, aus denen die Hanse zusammengesetzt ist. „All diese Städte beziehen sich aufeinander, alle diese Städte umfassen einen gemeinsamen Raum und so begreifen sie sich auch.“ Interessante Einblicke, gelungene Parallelen und ein erfrischend anderer Blick auf das große Thema der Globalisierung sorgten für eine kurzweilige Vorlesung am Donnerstag. Weiter geht es in der Ringvorlesung am 4. November mit Professor Dr. Michael Rauscher vom Lehrstuhl Außenwirtschaft am Institut für Volkswirtschaftslehre. In seiner Vorlesung widmet er sich der Globalisierung der Wirtschaft und dem Klimawandel. Organisiert wird die Vorlesungsreihe vom Wissenschaftsverbund Um-Welt (WVU). Der WVU ist ein Zusammenschluss der mit Umweltfragen beschäftigten Institute an der Universität Rostock. Die Vorlesungen finden bis zum 27. Januar 2011 immer donnerstags um 17:15 statt, das vollständige Programm gibt es auf der Website des WVU. Interessierte Gäste sind zu den kostenlosen Vorlesungen herzlich willkommen.
30. Oktober 2010 | Weiterlesen
Zwo, Eins, Risiko – Rostocks-offene-Bühne-Show
Freitagabend, 22 Uhr. Eine Zeit, die man eher mit dem Studentenkeller in Verbindung bringt als mit dem Theater. Und doch hatten die ungefähr 100 Gäste im Foyer des Theaters im Stadthafen sicher mehr Spaß, als die Besucher der diversen Rostocker Clubs und Kneipen, zumal der Alkohol sogar umsonst gereicht wurde. Aber dazu später mehr. Die Leitung des Abends übernahm Rawman, der in Begleitung von Beautiful Sweatlana und Ugly Katharina auch die Show eröffnete. Es gab den Titelsong „Zwo, Eins, Risiko! – Rostocks-offene-Bühne-Show“ zu hören. Rawman sang und spielte Gitarre, Sweatlana bediente das Akkordeon und Katharina hielt Zettel mit dem Text hoch. Nach dem Lied wurde das Publikum auf den Schlachtruf des Abends eingeschworen. Auf die Frage „Rostock, are you happy?“ sollte ein „Happy, Happy, Happy“ als Echo ertönen. Und natürlich haben die Zuschauer lautstark mitgemacht. Rawman erzählte, wie er zu dieser Show kam. Er wollte in Rumänien Sweatlana heiraten. Dies wollte ihr Vater aber nicht. Da der jedoch Mafiachef ist, mussten die beiden fliehen, durch ganz Europa und endlich hier in Rostock haben sie einen Platz gefunden, wo sie bleiben können. Auch wenn der rumänische Akzent nicht ganz fehlerfrei war und der Schnurrbart verdächtig wackelte, war die Geschichte überzeugend. Der erste Akteur auf der Bühne war ein alter Bekannter. Peter Thiers, der schon den Poetry Slam im ST veranstaltete, machte auch hier wieder eine gute Figur. Seine zwei geslammten Texten handelten vom Niedergang der deutschen Kulturlandschaft und dem Aufstieg von Krampfadlern. Danach folgte eine Theatergruppe aus Polen, die ein Stück ohne Worte präsentierten. Zwei Personen saßen auf der Bühne, ließen sich ehrfurchtsvoll Handys bringen und verteilten sie am Ende im Publikum. Der Hintergrund? Keine Ahnung. Nun war Publikumsbeteiligung gefragt. Es sollten Lieder eines Nasenflötisten erraten werden. Hits wie Hänschen Klein oder Final Countdown klingen durchaus eigenwillig auf diesem Instrument, weshalb das Erraten sichtlich schwerfiel. Der Gewinner bekam eine Freikarte für das Theater, die anderen bekamen Schnaps. Überhaupt wurde der Schnaps sehr großzügig verteilt. Für gutes Aussehen oder besonderes Klatschen gab es ein kleines Glas. „So ein Abend ist einfach leichter, wenn das Publikum betrunken ist“, verkündete Rawman. Dann betrat Jörg Hückler die Bühne. Kenner des Theaters wissen, dass er seit 2010 der Chefdramaturg und Schauspieldirektor am Volkstheater ist. Er las die Geschichte von Julia und Anton vor, in der es darum geht, wie zwei Kinder ein Theater besuchen. Dabei waren Ähnlichkeiten zu real existierenden Personen rein zufällig. Doch Hückler sollte nicht der einzige Gast aus dem Ensemble des Volkstheaters bleiben. Nach ihm betrat Stephan Fiedler das Podest. Der Schauspieler, der in der aktuellen Spielzeit zum Beispiel den Schimmelreiter spielt, ließ den Ärger heraus. Nicht seinen eigenen, sondern den von zwei Personen aus dem Publikum. Sie sollten eine Situation beschreiben, in der sie sich hätten ärgern wollen, es aber runtergeschluckt haben. Diese Szene stellte er dann lautstark auf der Bühne nach, was schon beim Zuschauen äußerst befreiend war. Nach ihm folgte der schüchtern wirkende Mythto. Mythto heißt mit richtigem Namen Jörg Schulze und ist auch Schauspieler. Er hielt einen langen, philosophisch angehauchten, Monolog, der dann in einem Schwall aus „Deine Mutter“ Witzen mündete. Das war so herrlich flach, dass man schon wieder darüber lachen musste. Als Nächstes durfte die polnische Theatergruppe wieder ran. In der zweiten Performance zeigten sie, wie man ohne Instrumente Musik machen kann. Mit Klatschen, Küssen und anderen Körpergeräuschen kam so ein ganzes lautmalerisches Orchester zusammen. Dann ein weiteres Highlight. Die eigenwillige Zaubershow von Alexis Scharbernakis und seiner Assistentin Alexa Kakerlakis. Es gab drei Tricks, wenn man das Outfit nicht mitzählt, und der Höhepunkt war sicherlich die Schwebenummer mit Jörg Schulze. Vollkommen unwahrscheinlich natürlich, dass er eingeweiht war. Der letzte Auftritt des Abends gehörte Theresa, die eine Diskussion zum Thema Trash eröffnen wollte. Mit ihrem sehr eingenwilligen Text hat sie es zumindest mal geschafft, viele Fragezeichen in das Foyer zu zaubern. Abschließend gaben Rawman und Sweatlana noch einmal den Titelsong zum Besten und verkündeten, dass die nächste offene Bühne im Januar stattfinden wird, bei der dann auch verraten werden soll, wie Sweatlana ihr Auge verloren hat. Kurz vor Mitternacht war die Show vorbei. Und was ich fast vermutet hatte, bestätigte sich. Rawman ist gar kein Rumäne, sondern Michael Ruchter, ebenfalls Schauspieler am Volkstheater. Er hat mit der Dramaturgin Janny Fuchs, besser bekannt als Beautiful Sweatlana, den Abend geplant und die Beiträge zusammengestellt. Er war froh, dass die Resonanz so positiv war und auch viele Leute mitmachen wollten. Und auch bei der nächsten Show im Januar kann jeder, der etwas kann, wieder mitmachen. Einfach eine E-Mail an Janny Fuchs vom Volkstheater schicken und beschreiben, was man machen will. Zuschauen kann man aber einfach so, einfach die Programme vom Volkstheater im Auge behalten und auf das FreitagNachtFoyer achten.
30. Oktober 2010 | Weiterlesen
Einstimmung auf die 9. Rostocker Lichtwoche 2010
Am 1. November 1879 beantragte der amerikanische Erfinder Thomas Alva Edison ein Patent für eine elektrische Lampe. Damit wurde das Elektrozeitalter eingeläutet. Schon bald erleuchteten überall in den Häusern und Straßen seine Glühbirnen. Die Städte wurden dadurch sicherer und die Menschen konnten auch nach Sonnenuntergang noch arbeiten. Doch die altehrwürdige Edison-Glühbirne hat ausgedient. Bis 2012 sollen nach dem Willen der Europäischen Union die heiß strahlenden Leuchtmittel aus dem Verkehr gezogen werden. Auf Deutschland bezogen soll mit dem Verbot des energiefressenden Leuchtmittels der CO2-Ausstoß um 0,5 Prozent gesenkt werden und damit zur Rettung der Welt beigetragen werden. All jene, die um die Glühbirne trauern, können nun in einer Ausstellung des Rostocker Objektkünstlers Bert Preikschat im Haus der Stadtwerke noch bis zum 19. November würdevoll Abschied nehmen. Als „Hommage an die Glühlampe“ hat der Künstler drei schneeweiße Urnen mit Glühbirnen auf schwarzem Samt und mit weißen Federn geschmückt angerichtet. Doch Vorsicht – am Fuße des Tisches, unter dem Tuch lauern schon die neuen Leuchtmittel. „Ich bedaure, dass die Glühbirne abgeschafft wird“, gibt Bert Preikschat zu. Für seine Objekte, die er größtenteils extra für diese Ausstellung entwickelt hat, hat er sie deshalb noch einmal in Szene gesetzt. „Stromschleuder“, „Kabelbaum“, „Glühlampen-Experiment“ oder „Schach matt für die Glühlampe“ nennt er seine Kreationen. „Ohne Licht geht gar nichts“, meint Bert Preikschat. „Als Künstler braucht man das Licht, um kreativ zu sein.“ Für ihn persönlich ist es zu einem wichtigen Gestaltungsmittel geworden. Bereits in der diesjährigen Lichtklangnacht konnte er die Besucher im IGA-Park mit seinen Installationen beeindrucken. Aber nicht nur der Lichtkunst hat sich der Rostocker Objektkünstler verschrieben. Seit 30 Jahren sucht und sammelt er die Ostseestrände nach interessanten Fundstücken ab, die er zu Strandgut-Collagen zusammensetzt. Auch von diesen Arbeiten sind einige Exemplare, wie zum Beispiel vier individuell gestaltete Fischkisten, in der Ausstellung zu sehen. Eröffnet wurde die Ausstellung „Keine Kunst ohne Licht“ am Vorabend der 9. Rostocker Lichtwoche. Zu Beginn der dunklen Jahreszeit, vom 1. (131 Jahre nach Edisons Patentanmeldung) bis zum 6. November, rücken die Rostocker Stadtwerke Teile der Rostocker Innenstadt in ungewöhnliches und buntes Licht. Für Unterhaltung sorgt ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Tanz, Performances und natürlich Licht- und Feuershows.
30. Oktober 2010 | Weiterlesen
Stirbt der Ländliche Raum in Europa?
Stirbt der Ländliche Raum in Europa? Kurze Frage, kurze Antwort: Nein, er stirbt nicht. So zumindest lautete das einhellige Fazit bei der gestrigen Podiumsdiskussion an der Universität Rostock. Etwas mehr gab es in der gut zweistündigen Veranstaltung natürlich schon zu erfahren. Die Ursachen für Probleme im Ländlichen Raum sind ganz klar bei der negativen Bevölkerungsentwicklung zu suchen, erläuterte Professor Dr. Gerald Braun vom Hanseatic Institute for Entrepreneurship & Regional Development (HIE-RO). Und hier gibt es ein deutliches Ost-West-Gefälle: „Die großen Schrumpfungsraten liegen in Mittel- und Osteuropa.“ Betroffen seien vorwiegend die ländlichen Gebiete. Hinzu kommt die Abwanderung der jungen Leute in die Städte. „Wenn die Schule stirbt, stirbt das Dorf“, heißt es in Zypern. „Ich bin entsetzt“, klagt Braun, „wie man dem Sterben der Schulen zugekuckt hat.“ Was aber kann man tun? Passivsanierung sei eine Strategie, erläutert der Professor. Frei nach dem Motto, Reisende kann man nicht aufhalten, die Abwanderung in Kauf nehmen und für die Alten, die „Fußkranken der Völkerwanderung“, eine soziale Grundsicherung bereitstellen. Stabilisierung sei die zweite Strategie, wobei Braun gar nicht von Wachstum reden wollte, das es vereinzelt auch im Ländlichen Raum durchaus gibt. Erfolgreich könne diese Strategie nur sein, wenn die urbanen Zentren im Ländlichen Raum gestützt werden – die sogenannte Oasenstrategie. Oasen fördern, statt nach dem flächendeckenden Gießkannenprinzip Wüsten zu bewässern, sei angesagt. Ankerstädte, wie Stralsund oder Greifswald, könnten die Abwanderung zumindest bremsen, sodass die „Leute nicht gleich bis New York laufen“, stellt Braun es etwas überspitzt dar. Da dürfte natürlich immer noch viel Platz für Wüstengebiete bleiben – wer knipst das Licht aus? Es klinge zwar schrecklich, so Braun, doch „diese Wüsten würde ich einer Passivsanierung überlassen. Das regelt sich von selbst.“ Ob denn analog zu den Rückbauprogrammen in Städten auch ähnliche Initiativen für den Ländlichen Raum vorgesehen seien, wollte Dr. Ulrich Vetter, Moderator des Abends wissen. Noch nicht, stellte Lutz Scherling vom Landwirtschaftsministerium MV klar. Bisher gibt es nur eine Art „Schandfleckenbeseitigungsprogramm“. Ein Rückbauprogramm für den Ländlichen Raum wäre aber durchaus wünschenswert, so Scherling. Momentan würde man im Land aber eher darum kämpfen, das Städtebauprogramm überhaupt zu erhalten. Doch, wo stehen wir im EU-Vergleich denn bei der Entwicklung des Ländlichen Raumes überhaupt? Verglichen mit Polen oder dem Baltikum stünden wir mit unserer Infrastruktur ganz gut da, erläuterte Werner Kuhn (CDU), Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Mit Blick auf Skandinavien wären wir aber doch nur Mittelfeld. „Wenn wir uns gut fühlen wollen, schauen wir Richtung Osten, wenn wir ein Ziel brauchen, nach Norden“, fasste es Vetter etwas salopp zusammen. Was macht man aber nun konkret im Ländlichen Raum? Die Schaffung mobiler Dienstleistungen sei ein wichtiges Thema, so Braun: „Die Krankenschwester, die einmal in der Woche ins Bürgerhaus kommt. Die Bücherei mit Videos und CDs, die einmal in der Woche ins Bürgerhaus kommt. Der Arzt, der einmal in der Woche Sprechstunden hat. Vielleicht auch der Pfarrer, der einmal in der Woche die Leute beerdigt.“ Wer von den jungen Leuten würde denn freiwillige aufs Land gehen, kam ein Einwand aus dem Publikum. Wer würde denn sagen, „ich freue mich aufs Frischemobil am Donnerstag, ich freue mich auf das Zeltkino auf dem Dauercampingplatz?“ Da würde es wohl doch an jungen Leuten fehlen, die das mitgestalten wollen. Eine provokante These gab es zum Abschluss auch noch, allein schon, damit der Abend nicht gar zu harmonisch verläuft. „Die Fischer sind ihre eigenen Totengräber“, erklärte Michael Popp von der EU-Kommission auf eine Publikumsfrage nach den Fangquoten. „Das ist von der Nationalität her völlig unabhängig“, führte er weiter aus. Angesichts der gerade erst für unseren Ostseeraum erneut deutlich herabgesetzten Heringsquote mag sich der eine oder andere Zuhörer verdutzt die Augen gerieben haben. Und hatte nicht Dr. Cornelius Hammer, Leiter des Instituts für Ostseefischerei (IOR), erst kürzlich beim Besuch der Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner klar festgestellt, dass die hiesigen Fischer an den Rückgängen der Bestände keine Schuld träfe? Werner Kuhn, auch Mitglied im Fischereiausschuss, konnte da nur heftig widersprechen. Die Wissenschaftler des IOR würden den Küsten- und Kutterfischern unseres Landes genaue Vorgaben machen, welche Fanggrößen mit einer nachhaltigen Fischerei verträglich sind. Bei den nochmals gesenkten Heringsquoten würden einige Fischer nun „den Schlüssel rumdrehen und Schluss machen.“ Jetzt seien Übergangszahlungen aus dem Fischereifond notwendig, damit die kleinen Fischereibetriebe nicht kaputt gehen – für Kuhn auch Oasen, die bewässert werden müssen. Zurück zum Fazit der Runde: Der Ländliche Raum wird sich verändern, aber nicht sterben, da waren sich die Teilnehmer einig. Nur Professor Braun war sich in diesem Punkt nicht ganz sicher, aber immerhin hofft er doch, „dass diese Art von Diskussion nicht sterben wird.“
29. Oktober 2010 | Weiterlesen
Jugendkommission der UBC tagt in Warnemünde
Ob in Gävle oder Guldborgsund, Kaliningrad oder Kemi, Riga oder Rostock – Jugendliche rund um die Ostsee teilen gemeinsame Interessen und stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Sei es nun die Planung der eigenen Zukunft, die Suche nach einer geeigneten Ausbildung oder einfach nur die Freizeitgestaltung. Viele machen dabei die Erfahrung, dass ein Blick über den Tellerrand zu den Nachbarn das eigene Bemühen vor Ort bereichern kann. Aus diesem Grund fand in den letzten beiden Tagen ein Arbeitstreffen der Jugendkommission der Union of the Baltic Cities (UBC) in Warnemünde statt. 31 Jugendliche und mit Jugendarbeit befasste Beschäftigte der Kommunen aus elf Städten in Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Russland, Schweden und Deutschland trafen sich, um Ideen auszutauschen und gemeinsam Projekte zu entwickeln. Im Mittelpunkt stand dabei das Thema Beschäftigungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen von jungen Menschen in ihren jeweiligen Städten. Die internationalen Vertreter stellten dazu die Situation in ihrer Region vor und erläuterten, mit welchen Möglichkeiten Jugendliche bei ihrem Weg in die Berufswelt unterstützt werden können. Viele organisieren Informationsangebote zur Berufswahl, bieten Seminare an oder vermitteln Sommer-Jobs für Schüler. „Für uns ist wichtig, dass die Belange Jugendlicher auch in der kommunalen Politik ausreichend berücksichtigt werden“, sagt Robert Lang. Der 21-jährige Student aus Estland engagiert sich in der Sport- und Jugendarbeit seiner Heimatstadt. Vor vier Jahren hat er zum ersten Mal an einem Treffen der Jugendkommission der Union of the Baltic Citys teilgenommen und schätzt seither den Austausch: „Man bekommt neue Ideen und viele nützliche Tipps, wie man diese umsetzen kann.“ Im Sommer hatte die Jugendkommission einen Fragebogen entwickelt, mit dem sie ermitteln will, auf welche Weise „Jugendthemen“ in der lokalen Politik verankert sind und welche Strategien der Jugendarbeit verfolgt werden. Fragen zur Beteiligung junger Menschen an politischen Entscheidungen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit oder Ausbildungsmöglichkeiten spielten dabei ebenso eine Rolle, wie Gesundheits- oder Sozialthemen. Der Fragebogen kann noch bis Dezember beantwortet werden. Trotzdem wurden auf dem Arbeitstreffen schon die ersten Zwischenergebnisse ausgewertet. Demnach hat eine große Mehrheit der befragten Städte der UBC eine Strategie für ihre Jugendarbeit in ihrer politischen Agenda vorgesehen (64%) oder plant eine solche aufzunehmen. Nur für vier Prozent spielt dieses Thema keine Rolle. Die Union of the Baltic Cities (UBC) ist eine Vereinigung von über 100 Ostseestädten und dient als dezentrales Netzwerk grenzüberschreitender kommunaler Zusammenarbeit im Ostseeraum. Rostock war vor 19 Jahren Gründungsmitglied der UBC. Die Jugendkommission (Commission on Youth issues) der UBC gehört zu den jüngsten. 80 Städte aus acht Ländern beteiligen sich an ihrer Arbeit.
29. Oktober 2010 | Weiterlesen
Wissenschaftsspielplatz „Eureka“ zu Gast in Rostock
Wer glaubt, dass Physik und andere Naturwissenschaften langweilig sind, der kann sich von dem „Eureka“ Projekt aus Stettin in Polen eines Besseren belehren lassen. Im Rahmen der EUROPA-Tage, die momentan in der Universität stattfinden und vom Akademischen Auslandsamt veranstaltet werden, waren die Wissenschaftler zu Gast im Foyer des AudiMax. Neun Leute arbeiten in Stettin für „Eureka“. Vor acht Jahren wurde das Projekt von der mathematischen und physikalischen Fakultät der Universität Stettin ins Leben gerufen, unterstützt von der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Anfangs gab es nur zehn kleinere Experimente, inzwischen sind es ungefähr 150. In Stettin gibt es an mehreren Stellen themenbezogene Standorte des Projekts, weitere sind noch in Planung. Neben einem Vertreter der Universität Stettin waren zwei Forscher aus Polen mit nach Deutschland gekommen, um die Experimente zu betreuen. Bartosz Klepacki und Grzegorz Aslamowicz sind schon von Beginn an bei Eureka dabei und hatten sichtlich Spaß, die Gäste zu täuschen und zu verblüffen. Die beiden sind der Meinung, dass Physik nicht nur durch Bücher gelehrt werden soll. Dadurch, dass man die Phänomene selbst erleben kann, merkt man sie sich auch besser. Etwa 15 kleinere und größere Experimente hatten Bartosz und Grzegorz dabei. Thematisch drehte es sich vor allem um optische Täuschungen, Seifenblasen, Wellen, Strom und die Wirkung von flüssigem Stickstoff. Dadurch, dass parallel im Hörsaal die Kinderuni stattfand, hatten die zwei Wissenschaftler alle Hände voll zu tun. Viele staunende Blicke waren das Ergebnis der Bemühungen. Es war für die Kinder zum Beispiel möglich, sich in ein Becken mit Seife zu stellen und dann von einer großen Seifenblase gefangen zu werden. Es durften aber auch selbst kleine Seifenblasen gemacht werden, die fast wie Klebstoff wirkten und auf der Haut haften blieben. Gregorz zeigte außerdem, was man alles mit flüssigem Stickstoff anfangen kann. Eine Waffelrolle hineingetaucht, gegessen und schon konnte man kalten, weißen Rauch durch die Nase pusten. Eine besondere Erfahrung war es auch, sich unter Strom setzen zu lassen. Auf einer Matte stehend, wurden die Kinder mit 50000 Volt geladen, was dazu führte, dass ihnen die Haare zu Berge standen. Die achtjährige Elizabeth Wagner hat es ausprobiert und berichtet, dass man bis auf ein leichtes Ziepen nichts gemerkt hat. Und natürlich die Entladung am Ende: „Das kenne ich vom Trampolin springen, da passiert das manchmal auch. Trotzdem haben mir die Seifenblasen am besten gefallen.“ Ein Vergnügen für alle Altersklassen – heute und morgen besteht jeweils von 10 bis 16 Uhr noch die Möglichkeit, den Wissenschaftlichen Spielplatz Eureka im Foyer des AudiMax zu besuchen.
28. Oktober 2010 | Weiterlesen
Youth in Europe - 4. Europäische Plakatbiennale
„Frieden den Menschen – Frieden der Natur“ mit diesem Thema beschäftigten sich vor etwa zwei Jahren junge Studenten europäischer Kunst- und Designschulen und setzten ihre Ideen bildnerisch in Plakate um. Sie nahmen damit an der 4. Europäischen Plakatbiennale „Youth in Europe“ teil, die vom Neuen Kunstkreis e.V. aus Anklam initiiert wurde. Eine große Auswahl der Ergebnisse kann anlässlich der EUROPA-Tage an der Universität Rostock noch bis zum 9. November in der Kunstschule Rostock in der Friedrichstraße 23 (Frieda 23) besichtigt werden. Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, zwischen Menschen untereinander, das Leben in einer globalisierten Welt, Klimawandel, Krieg, Gewalt unter Jugendlichen, Missbrauch in der Familie, Folgen des Konsums von Zigaretten und Alkohol – zu vielen Aspekten des sehr allgemeinen Themas des Wettbewerbs haben die jungen Gestalter etwas zu sagen und beziehen dazu kritisch Stellung. Durch ihre originelle Bildsprache machen sie in der Ausstellung auch deutlich, dass trotz der Konkurrenz durch andere Medien, das Plakat immer noch das Mittel der Wahl ist, um Botschaften laut und direkt auszudrücken. „Es ist in der Lage eine Kunstform von großer emotionaler Wirkung zu sein auch über Sprachgrenzen hinweg“, meint Professor Otto Kummert von der Designschule in Anklam und Begründer dieser Plakatbiennale. Ziel des Plakat-Wettbewerbs sei es, dass die studentische Jugend Verantwortungsgefühl gegenüber der Öffentlichkeit entwickelt. Otto Kummert erklärt dazu: „Die Teilnehmer sollen erkennen, dass Mediengestaltung soziale sowie ökologische Anliegen wirkungsvoll verbreiten kann und damit zum Gegenteil von verantwortungsloser Manipulation wird.“ Die persönliche Auseinandersetzung der Studenten mit dem Thema und die Herausforderung die eigenen Gedanken und Ideen in einem Plakat zu veranschaulichen sind daher nur ein Teil des Wettbewerbs. Der eigentlich wichtige Teil, so der Organisator, ist die öffentliche Ausstellung der Ergebnisse. Wer sich darüber hinaus vertiefend mit einzelnen Motiven beschäftigen möchte, für den besteht die Möglichkeit, einen Katalog oder einzelne Plakate zu erwerben. Vor allem die Arbeit in Schulen und in der Jugendarbeit soll damit bereichert werden. Nach der vierten steht nun die fünfte Europäische Plakatbiennale vor der Tür. Noch bis zum 22. November können Studenten europäischer Kunst- und Designschulen Plakate zum Thema „mare nostrum“ einreichen. Vielleicht sind die Ergebnisse dann auch wieder in Rostock zu sehen.
28. Oktober 2010 | Weiterlesen
Jugendtheaterprojekt „In meinem Himmel“ feiert Premiere
In der letzten Woche bekam ich eine Mail von Alex, der mich fragte, ob ich Lust hätte, über ein Rostocker Theaterstück zu schreiben. Er lud mich auch zur Generalprobe am letzten Sonntag ein. Ich habe die Einladung gerne angenommen, ohne viel zu erwarten. Doch am Ende der Generalprobe war ich mehr als begeistert. Doch von Anfang an. Ich betrat also den großen Saal des Peter-Weiss-Hauses und war überrascht. Jeweils drei Reihen Stühle waren links und rechts an der Wand aufgestellt, quer zur Bühne und in der Mitte auf dem Boden lagen Maisblätter. Außerdem waren noch drei Podeste zu sehen, auf denen sich die Handlung abspielte. Das Stück, welches gespielt wird, heißt „In meinem Himmel“ und beruht auf einem Roman von Alice Sebold. Anfang des Jahres gab es auch eine Verfilmung unter der Regie von Peter Jackson. Bereits am Anfang des Buches wird das 14-jährige Mädchen Susie Salmon vergewaltigt und getötet. Daraufhin kommt sie in eine Zwischenwelt und beobachtet die Menschen auf der Erde, ihre Familie und Freunde, wie sie mit ihrem Verschwinden umgehen. Man bekommt einen Blick dafür, wie Menschen versuchen, nach einem Verlust, wieder ein normales Leben zu führen. Der Regisseur Christof Lange verriet mir, dass er den Film gesehen hat und fand, dass gerade die zwischenmenschliche Ebene viel zu kurz kommt. Daraufhin hat der 23-Jährige, der nebenbei im Volkstheater arbeitet und später einmal Regie studieren will, in drei Monaten ein Drehbuch geschrieben und Leute ausgesucht, die zu den Rollen passen. Man kannte sich vom Jugendtheaterklub oder aus dem Freundeskreis. 15 Schüler und Studenten umfasst das Ensemble. Unterstützt wird das Projekt vom Peter-Weiss-Haus und im Speziellen durch die offene Kinder- und Jugendarbeit, die finanziell half, aber auch Requisiten und den Raum zur Verfügung stellte. Ich muss zugeben, dass ich sehr skeptisch war. Ich hatte nicht das Gefühl, bei einer Theaterprobe zu sein, sondern eher auf einer Klassenfahrt. Da wurde rumgealbert, ein USB-Stick gesucht und lustige Fotos entstanden natürlich auch. Man muss dazu sagen, dass viele Darsteller noch nicht einmal 16 Jahre alt sind und sie einen doch sehr ernsten Stoff spielen. Aber dann ging das Licht aus und die Show begann. Schon nach wenigen Minuten stellten sich meine Nackenhaare auf, Gänsehaut überkam mich. Das war so überzeugend, so echt, unglaublich. Man will schreien: „Susie, geh nicht mit deinem Nachbarn mit!“, so glaubhaft sind die Figuren angelegt. Ungefähr zwei Stunden geht das Stück und dabei kommt keine Langeweile auf. Ich bin jetzt noch erstaunt, wie großartig solch junge Menschen mit einem so ernsten Stoff umgehen. Ich hatte nie das Gefühl, in einem Theaterstück zu sein – ich konnte mich richtig in die Szenen reinversetzen. Doch nicht nur die Akteure überzeugten in ganzer Linie, auch die Musik und die Verwendung des Lichtes taten ihr übriges. Die Verteilung der Handlung auf Podeste macht das Stück sehr dynamisch und man hat trotz der nur spärlichen Kulissen eine sehr bildhafte Vorstellung von der Szenerie. Und ich muss zugeben, am Ende des Stückes hatte ich einen Kloß im Hals und feuchte Augen. Ich war sprachlos. Das alles ist in der Freizeit entstanden, zwei Monate wurde geprobt und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Ein sehr emotionales, spannendes Theaterstück, das einen mitnimmt in eine Welt, die über das Diesseits hinausreicht. So ging ich dann einen Tag später zur Premiere und freute mich für das Ensemble, dass alle Stühle besetzt waren. 100 Leute wollten sehen, was die Jugendlichen auf die Beine gestellt haben. Und auch die Premiere hat mir wieder eine Gänsehaut verpasst, obwohl ich die Geschichte ja schon kannte. Was soll ich noch mehr sagen, außer, dass es großartig war? So sah es wohl auch das Publikum, welches die Leistung mit zehnminütigen Standing Ovations auszeichnete. Familie Walter sagte mir später, dass es ihnen sehr gut gefallen hat. Die Eltern von Hagen, einem der Darsteller, waren anfangs skeptisch. Aber als sie merkten, wie viel Fleiß und Zeit in das Stück fließen, haben sie schon gedacht, dass es gut wird. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, sagte Petra Walter. Auch Grit Lauer war sichtlich angetan: „Ich bin begeistert, dass Teenies ein so schweres Thema schaffen. Ich hatte Gänsehaut und feuchte Augen.“ Ich kann euch also nur wärmstens empfehlen, euch eine der nächsten Vorstellungen von „In meinem Himmel“ anzuschauen. Das Stück wird noch bis ins kommende Jahr gespielt, die nächsten Termine sind am 29. und 31. Oktober sowie am 14. November.
27. Oktober 2010 | Weiterlesen



