Neueste Nachrichten aus Rostock und Warnemünde

Internationale Uwe-Johnson-Tagung in Rostock
„Bei uns schrieb er seine letzten Werke und starb. Hier, wo er womöglich seine ersten verfasst hat, lebt er jetzt auf und lebt er weiter.“ So brachte es Dr. Robert Gillet von der Queen Mary University of London gestern in seinem Eröffnungsvortrag zum Ausdruck. Die Rede ist von dem Schriftsteller Uwe Johnson, dessen Werk und Leben sich seit gestern eine viertägige internationale Tagung in Rostock widmet. „Ohne Werk, kein Leben. No writing, no life“, brachte Gillet es auf den Punkt. Und so steht die Tagung folgerichtig ganz unter dem Motto „Uwe Johnson. Werk und Leben“. Ausgerichtet wird das Treffen von der gerade erst gegründeten Uwe Johnson-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistik der Universität Rostock. Prof. Dr. Holger Helbig, Gründungsmitglied und Inhaber der Uwe-Johnson-Stiftungsprofessur, hat die wissenschaftliche Leitung übernommen. Drei Monate nach der Gründung erlaube es die Tagung, „auf erfreuliche Art und Weise zeigen zu können, dass es uns gibt“. Möchte die Uwe-Johnson-Gesellschaft doch ebenso Anlaufpunkt für die Forschung wie auch für alle Fans des Schriftstellers sein. Sein Dank ging an den Rektor der Universität Rostock, Wolfgang Schareck, der die Pflege und Förderung Uwe Johnsons zur Chefsache erklärt habe. Nicht zu vergessen sei Dr. Ulrich Fries, der Stifter der Professur. Immer wieder habe er die Johnson-Forschung angeregt und unterstützt, „beileibe nicht nur mit Geld, aber auch damit“, so Helbig. Ohne ihn würde es weder das Johnson-Jahrbuch noch den Kommentar zu den „Jahrestagen“ geben. „Man kann Wissenschaft nicht unter einer Glasglocke betreiben“, betonte Helbig. Ziel der Gesellschaft und der Tagung sei es daher, nicht nur die Ergebnisse der Forschung öffentlich zu machen, sondern das „Erlebnis Literatur“ zu vermitteln. Unterstützt wird die Tagung vom Literaturhaus sowie von der Hansestadt Rostock. Im repräsentativen Ambiente des Bürgerschaftssaals findet die Tagung im Rathaus statt und „wir sind tatsächlich eingeladen worden, die Räume zu nutzen und nicht etwa zu mieten“, so Helbig. Für Roland Methling eine Selbstverständlichkeit. „Jetzt kommt zusammen, was zusammengehört“, fühlte sich der Oberbürgermeister an die Wendezeit erinnert. „Rostock war es Uwe Johnson wert, gut von dieser Stadt zu schreiben und vermutlich auch gut an sie zu denken.“ Aus diesem Grund will und wird Rostock das Andenken Uwe Johnsons bewahren, bekräftigte Methling. Dazu gehöre auch weiterhin „der Traum des Oberbürgermeisters, an der Nordkante des Neuen Marktes ein Zuhause für die Literatur zu schaffen – mit Kempowski, mit Uwe Johnson und mit unserem Rostocker Literaturhaus“. Auch für Rektor Wolfgang Schareck war die Umgebung eine neue Erfahrung: „Ich hab das erste Mal die Gelegenheit, von diesem Pult zu sprechen. Hier steht es sich gut, Herr Oberbürgermeister!“ Gibt es da etwa Ambitionen? „Doctrina multiplex – veritas una“ – als das Motto der Universität entwickelt wurde, war mit Wahrheit sicher etwas anderes gemeint, als es Uwe Johnson getrieben hat. Und doch, so Wolfgang Schareck, sei es die Wahrheitsliebe gewesen, die Uwe Johnson hier in Rostock zum Schriftsteller werden ließ. Rostock war es, wo Uwe Johnson sich gegen Schauprozesse stellte, wo er sich gegen das wandte, was die SED mit der Jungen Gemeinde machte und wo er der DDR Verfassungsbruch vorwarf. Auch wenn es von 1952 bis 1954 nur ein kurzer Abschnitt war, den Johnson an der Rostocker Universität verbrachte, sei es doch ein für ihn prägender gewesen. Von allen Autoren, die mit Rostock verbunden sind, sei Uwe Johnson zweifelsfrei der gewichtigste, betonte Schareck. Johnsons Lebenslauf sei eine Reflexion der Zeit der deutschen Teilung mit all ihrer Problematik. Er ist auch der Nachkriegsautor, der international besondere Beachtung gefunden hat, wie man gut am Teilnehmerfeld dieser Tagung erkennen könne. „Rostock möchte ein Ankerpunkt für die Uwe Johnson-Forschung sein“, so der Rektor. Mit der Gründung der Gesellschaft sowie der Tagung sei eine gute Basis geschaffen, denn hier werde „nicht auf Netzwerke und Strukturen gebaut, sondern auf Themen.“ „Nach Vollkommenheit hege ich wenig Sehnsucht”, schrieb Johnson im Jahre 1952 an seine ehemalige Deutschlehrerin, „aber glücklich möchte ich von Zeit zu Zeit schon sein.“ An diesen Tagen in Rostock hätte der Schriftsteller bestimmt seine Freude gehabt. Und wer weiß, vielleicht schaut er dieser Tagung auch von oben zu und muss ab und an ein wenig schmunzeln über all die Auslegungen und Interpretationen seiner Werke und seines Lebens. Denn immer noch gilt: „Identität des Autors zweifelhaft“. Die Tagung läuft noch bis Sonntag. Interessierte sind herzlich willkommen, auf der Website der Gesellschaft gibt es das vollständige Programm.
28. Mai 2010 | Weiterlesen
Prüfung bestanden: Paula hat den Führerschein
„Die Prüfung läuft noch“, informiert Dr. Manfred Preetz, der Landesstellenleiter der Technischen Prüfstelle in der DEKRA-Niederlassung Rostock. Zu diesem Zeitpunkt, am 27. Mai, wird gerade die einmillionste Fahrerlaubnisprüfung abgenommen. Während wir auf das Ergebnis warten, stellt Dr. Gerd Neumann, Geschäftsführer vom DEKRA-Prüfwesen, die neueste technische Errungenschaft vor – die virtuelle Kundenakte. Damit steht eine komplette EDV-Lösung zur Verfügung, mit der alle Kommunikationsprozesse zwischen Fahrschule, technischer Prüfstelle und Fahrerlaubnis-Behörde zukünftig elektronisch ablaufen. Auf diese Weise verringert sich die aufwendige Papierablage und der Weg zum Führerschein verkürzt sich um neun Tage. „Die neue Anwendung bietet einen großen Vorteil für die Prüflinge“, erklärt Gerd Neumann: „Jeder, der die Führerscheinprüfung besteht, erhält noch vor Ort im Fahrzeug die gedruckte vorläufige Fahrberechtigung, mit der er sofort losfahren kann.“ So auch die 18-jährige Paula Schmidt, die mit dem Fahrschulwagen auf dem Gelände vorfährt. Sie hat gerade die praktische Fahrprüfung bestanden, die zum millionsten Mal seit 1990 in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich durchgeführt wurde. Nachdem sie aus dem Auto ausgestiegen ist, fällt sie ihrer Mutter überglücklich in die Arme. Diese bedankt sich beim Fahrlehrer Sven Patzer. Ihre Tochter Paula ist bereits das vierte Kind, welchem er das Autofahren beigebracht hat. „Sie war ganz sicher“, berichtet der Fahrlehrer von der Prüfungsfahrt, „es gab einen kleinen kritischen Moment bei der Verkehrsbeobachtung. Aber sie war sehr souverän.“ Die Schülerin selbst erzählt, dass sie beim Fahren aufgeregter war als sonst: „Am Anfang hatte ich Angst, aber Herr Patzer und der Prüfer haben sie mir genommen.“ In der nächsten Zeit, so die Schülerin, würde sie noch ungern allein fahren und hätte lieber noch jemanden an ihrer Seite. Die Schülerin kann sich vorstellen, ihre Mutter im Urlaub beim Autofahren zu entlasten. Ein eigenes Auto sei noch nicht nötig. Die Wege zur Schule und in der Stadt könne sie gut wie bisher auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen. Zu den ersten Gratulanten gehört auch der Verkehrsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern Volker Schlotmann. „Der Führerschein wird allgemein als Dokument des Erwachsenseins empfunden“, sagt er über dessen Bedeutung. Auch er freut sich über die bestandene Fahrprüfung. Angesichts der im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ hohen Durchfallquote ist es nicht selbstverständlich, die theoretische und praktische Fahrprüfung gleich beim ersten Mal, wie Paula Schmidt, zu bestehen. Zuvor hatte der Verkehrsminister schon die Unfälle, die überdurchschnittlich oft durch junge Fahrer verursacht werden, angesprochen. Aufgrund der positiven Erfahrungen des begleiteten Fahrens ab 17, kann er sich auch eine Senkung auf 16 Jahre vorstellen. „Unsere Jugendlichen sind nicht dümmer als in den USA. Warum soll das nicht möglich sein?“ schätzt Schlotmann ein und hat vor für diese Idee politische Mehrheiten zu gewinnen.
27. Mai 2010 | Weiterlesen
Ideenwettbewerb für Museumsgebäude
Dem ehemaligen „Rostocker Schifffahrtsmuseum“ gilt es wieder neues Leben einzuhauchen. Dieses traditionsreiche, maritime Museum der Hansestadt befindet sich in der August-Bebel-Straße 1 und ist schon von Weitem mit bloßem Auge als ein Sanierungsfall auszumachen. Um Abhilfe zu schaffen, gab es einen Ideenwettbewerb – am Dienstag luden Vertreter der Stadt zur Präsentation der Ergebnisse ins Kulturhistorische Museum ein. Das Gebäude ist für Rostock voller Geschichte und nicht nur architektonisch wertvoll. Anno 1875 von der Societät als Gesellschaftshaus erbaut, wurde es 1903 in die damalige Museumslandschaft eingebunden. Zu DDR-Zeiten diente es 35 Jahre als das bis heute bekannte Schifffahrtsmuseum. Mit der gesellschaftlichen Wende kam es ab 1989 aufgrund fehlender Gelder im Stadthaushalt zu Problemen. 2003 musste es gar geschlossen werden. Drei Jahre später übernahm der Nachfolger des einstigen Bauherrn, die Societät Rostock maritim e.V., das Museum ehrenamtlich. Im Rahmen eines von der Europäischen Union kofinanzierten Projektes wurde nun dieser Ideenwettbewerb von unseren Stadtoberen als Chance ergriffen, die Neuordnung der musealen Landschaft in Rostock anzupacken und das Museum in der August-Bebel-Straße gleich mit ins Boot zu holen. Möglichst saniert, versteht sich. Gastgeberin am Veranstaltungsort war die Leiterin des Kulturhistorischen Museums, Dr. Heidrun Lorenzen. Sie begrüßte alle Anwesenden im Kreuzgang des Klosters. Neben Projektverantwortlichen und interessierten Bürgern waren auch Oberbürgermeister Roland Methling und Kultursenatorin Dr. Liane Melzer erschienen. Der Ort der Präsentation war mit Bedacht gewählt worden. Schon seit Langem reichen die Räumlichkeiten des Kulturhistorischen Museums mit seiner Ausstellungsfläche von 1.866 qm nicht aus, um die sage und schreibe über 136.000 Objekte der Kultur- und Alltagsgeschichte unserer Region auch nur annähernd vorstellen zu können. Darum soll das ehemalige Schifffahrtsmuseum nun im Kulturhistorischen Museum aufgehen und auch räumlich eine Annäherung beider Gebäudekomplexe erreicht werden. Was meinte unser Stadtoberhaupt zu der Idee und den eingegangenen Projekten? Zunächst rekapitulierte Roland Methling die wechselvolle Historie des Hauses in der August-Bebel-Straße 1. Einem der letzten „hässlichen Entlein“ der Hansestadt würde nun bald der „Garaus“ gemacht werden. Im positiven Sinne versteht sich. Neben der gerade in Sanierung befindlichen „Großen Stadtschule“ am Rosengarten und dem Rathaus sei es das „letzte große Gesellschaftsgebäude in der Hansestadt Rostock, das einer Veränderung harrt“, so Methling. Er begrüßte den Ideenwettbewerb außerordentlich und bedankte sich für den Eingang der sieben Projektvorschläge. Eine fachkundige Jury habe alle eingereichten Arbeiten sorgsam studiert und kam zu dem Schluss, dass gleich zwei Projektteams ein zweiter Preis verliehen werde. Kein Erster zwar, aber in Kombination seien beide Ausarbeitungen zusammen die zurzeit attraktivste Variante. Preisträger sind die „GPK Architekten“ in Zusammenarbeit mit „Rutsch + Rutsch Innenarchitektur GbR“ und weiteren Zuarbeitenden, deren Konzept zur Einbindung des Museums in die Umgebung besonders gewürdigt wurde. Einen weiteren zweiten Preis erhalten die „dk architekten“ mit Sitz in Stuttgart. In ihrer Arbeit gelänge besonders die Verschmelzung von historischer und moderner Architektur. Dies führe beim Betrachter gleichsam zu einer Rückbesinnung auf den vorhandenen Standort. Auch infrastrukturelle Probleme am derzeitigen Standort sind überdeutlich. An das Haus August-Bebel-Straße 1 schließt sich ein nur etwa zwei Meter breiter Fußweg an, daneben eine Hauptverkehrsstraße. Die „GPK Architekten“ sehen deshalb eine Untertunnelung der viel befahrenen Straße an dieser Stelle vor. Der Tunnel verbindet eine flächige Absenkung im Bereich des Rosengartens und das Hauptgebäude am jetzigen Standort. Im Bereich des Tunnels können dann Tagungsbereiche, Kunstterassen, die Touristen-Information und auch ein Café angelegt werden. Ein Zugewinn an Ausstellungsfläche von nahezu 3000 qm ist möglich. Der OB regte an, einen weiteren Wettbewerb der Ideen auszuloben, der sich noch mehr mit den inhaltlichen Kriterien zum Museum befasse. „Man sollte weitermachen.“, so seine Ermunterung an alle Anwesenden. Damit übergab er das Wort der Kultursenatorin. Dr. Liane Melzer beschwor gleichsam die Vision eines „musealen Leuchtturmes von überregionaler Bedeutung“, die von dieser Neuordnung der Museenlandschaft in der Hansestadt ausgehen könne. Der Zugewinn an Ausstellungsfläche sei im Ideenwettbewerb gefordert und schließlich auch eingelöst worden. Das Gebäude des Schifffahrtsmuseums sei „wunderbar entwicklungsfähig“. Der Museumskomplex werde ganz klar auch zur Belebung der Innenstadt beitragen. Als Termin für die Fertigstellung dieses musealen Großprojektes ist das Jahr 2018 anvisiert. Ist noch etwas hin, denke ich bei mir. Dann wird Rostock 800 Jahre alt sein und vermutlich viel feiern. Warum nicht auch die Einweihung des neuen, erweiterten Standortes des Kulturhistorischen Museums in der August-Bebel-Straße 1? Das Einzige, was dem heute entgegensteht, dürften vermutlich die Kosten für dieses Vorhaben sein. Diese sind in der jetzigen Phase des Projektes noch nicht bekannt. Ob die Rostocker Bürgerschaft da Gelder zusagen wird? Interessierte und Neugierige können sich die sieben Projekte in der Ausstellung im Kulturhistorischen Museum noch bis zum 17. Juni 2010 zu den gewohnten Öffnungszeiten ansehen.
27. Mai 2010 | Weiterlesen
Grundsteinlegung für Hörsaal der Uni Rostock
Der Grundstein für einen weiteren Hörsaal auf dem Campus Ulmenstraße wurde gelegt, ein wichtiger Meilenstein zum Bau des spiegelverkehrten Zwillingsbruders des Audimax, welcher sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet. Von außen wird das neue Gebäude in seiner Form und Gestaltung dem bereits 2004 errichteten größten Hörsaal der Universität Rostock ähneln. Als Fassade werden schuppig übereinanderliegende patinierte Kupferplatten Natursteinwände und große Glasflächen zum Einsatz kommen. Der Stahlbeton- und Eingangskubus wird farbig vom gegenüber befindlichen Audimaxgebäude abgesetzt. Mit dem Bau, der im Herbst 2011 fertig gestellt sein soll, wird die Gestaltung des denkmalgeschützten Kasernenkomplexes in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt abgeschlossen. Der architektonische Kontrast der beiden modernen Hörsaalgebäude zu den historischen roten Backsteinbauten verkörpert auf architektonische Weise das Motto der Universität Rostock: „Traditio et Innovatio“. „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft“, zitiert Rektor Professor Dr. Wolfgang Schareck den Ehrendoktor der Universität Albert Einstein. Der Hochschulleiter freut sich über den Neubau und versichert, dass mit dem 4,1 Millionen teuren Bau in die Zukunft investiert werde. Gerade im Hinblick auf die von Studierenden oft angemahnten schwierigen Hörsaalbedingungen, stelle das neue Gebäude eine Entlastung dar. Um zwei Hörsäle mit 300 und 250 Plätzen wird die Lehrveranstaltungskapazität nun erweitert. Auf dem neuesten Stand der Technik werden diese mit entsprechenden audiovisuellen Medien ausgestattet. Mit dem im Auditorium Maximus bereits installiertem System wird es sogar möglich sein, simultan gestaltete Vorlesungen oder Kongresse für bis zu 1050 Teilnehmern durchzuführen. „Die Bedingungen für Lehrende und Lernende werden sich verbessern“, sagte auch der Bauminister des Landes Mecklenburg Vorpommern Volker Schlotmann, der zur Grundsteinlegung aus Schwerin angereist war, um den Beteiligten seine Glückwünsche zu übermitteln. Gemeinsam mit Professor Dr. Wolfgang Schareck bestückte er die Kupferkassette mit Bauplänen, zwei Tageszeitungen, Münzen, einem Informationsblatt und einer Urkunde, bevor sie in den Bau eingemauert wurde. Nach einer alten Tradition soll dieses Bauopfer den Sinn und Zweck des Baues befördern.
27. Mai 2010 | Weiterlesen
„Klima schützen kann jeder – Schüler StAUNen …“
Karina Jens zeigte sich heute nicht nur erfreut über das einfallsreiche Wortspiel „Schüler StAUNen …“, in dem das Kürzel des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur (StAUN) Rostock enthalten ist. Auch die Tatsache, dass 37 zum 13. Schülerprojektwettbewerb des StAUN eingereichte Projektarbeiten an diesem Tag im Foyer des Rathauses bestAUNt werden konnten, erfüllte sie mit Freude. Die Bürgerschaftspräsidentin der Hansestadt Rostock eröffnete den Aktionstag „Klima schützen kann jeder – Schüler StAUNen …“, zu dem das Rostocker StAUN, die Neue Verbraucherzentrale in Mecklenburg und Vorpommern e.V. sowie die Klimaschutzleitstelle Rostocks eingeladen hatten. Dabei verriet sie, in Rostock sei in Sachen Klimaschutz in den vergangenen Jahren schon allerhand geschehen. So konnte etwa „der Ausstoß von Kohlendioxid im regionalen Bilanzrahmen um knapp die Hälfte reduziert werden“. Das StAUN hatte den 13. Schülerprojektwettbewerb schon im Oktober 2008 ausgeschrieben. Schülerinnen und Schüler aus Rostock und den Landkreisen Bad Doberan wie auch Güstrow waren dazu aufgerufen worden, einzeln, als Projektgruppe oder als Klasse Projektarbeiten einzureichen, die sich mit den Themen „Biologische Lebensräumen unserer Region“, „Wasser schützen“, „Nutzung von Abfällen, nachwachsenden Rohstoffen und regenerativen Energien“, „Küstenschutz in Mecklenburg-Vorpommern“, „Mobilität und Umweltschutz in der Region Rostock“ und „Klimaschutz schmeckt“ befassen. Auf der Schüleraktionsmeile im Rathaus konnten die Teilnehmer des Wettbewerbs ihre Projekte heute präsentieren. Zudem sollten 15 Preisträger feierlich geehrt werden. Dazu war auch der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V, Dr. Till Backhaus, in die Hansestadt gekommen. Isabelle Riedel, Theresa Engel und Natalja Bier von der Fritz-Reuter-Grundschule in Kühlungsborn erzählten mir, was sie alles im Juni 2009 während ihrer Projektwoche unter dem Thema Wiesenwelten erlebt hatten. Von Isabelle erfuhr ich mehr über das „Insektenhotel“, das die Schüler ihrer Schule gebaut hatten. Vor ihr auf dem Tisch ausgebreitet lagen verschiedene Hölzer, Steine und Stroh. „Also Insekten lieben es ja, wenn es so weich ist und auch hohl, wo sie hineinkriechen“, erklärte die Schülerin. Sie zeigte mir Rohrkolben, Schilf und ein Holunderästchen. Dies habe besonders weiches Mark. Das würden die Käfer mögen, so Isabelle. Auch einen Ziegelstein, in dem bereits Insekteneier platziert waren, konnte ich da entdecken. Theresa Engel zeigte mir ein Buch. Darin war die Vorlage abgedruckt, nach der die Schüler das Hotel für all die krabbeligen kleinen Tierchen gebaut hatten. Dann erklärten mir die drei noch viel Wissenswertes über Wildbienen, Schlupfwespen und Tausendfüßler. Ein weiteres kleines Abenteuer erlebten die Schüler, als ein Imker sie besuchte. Er habe ihnen allerhand von den Bienen erzählt und sogar welche mit in die Schule gebracht. Obendrein habe er den Schülern ein Glas Honig geschenkt, erzählten mir die Mädchen von der Kühlungsborner Fritz-Reuter-Grundschule. Natalja Bier und die ehemalige Schulleiterin, Monika Paulicks, sagten mir dann noch, was es mit der schönen Umweltzeitung auf sich habe, von der ich sogleich ein Exemplar kaufte. Monika Paulicks hatte das Umweltzeitungs-Projekt geleitet. Ziel der Zeitung sei es gewesen, „all die schönen Dinge, die wir in der Projektwoche unter dem Thema Wiesenwelten gestaltet haben, der Öffentlichkeit nahe zu bringen“, sagte sie. Auch werde die liebevoll aufbereitete Publikation als Dankeschön an alle Unterstützer des Projekts angesehen. Überdies würden die Projekte den Kindern auf diese Weise länger in Erinnerung bleiben, so Monika Paulicks. Natalja zeigte mir einige Fotos aus dem Druckwerk „Wiesen-Welten“. Ein Junge war da zu sehen, der einen sage und schreibe 1,10 Meter langen Löwenzahn gefunden hatte. Zwei Kinder hatten ein Gedicht für die Zeitung geschrieben und auch das „Insektenhotel“, der Imker und vieles, vieles mehr sind darin abgebildet. Schüler und Lehrer hatten Texte zu den Bildern verfasst. Das Thema Umwelt wird an der Fritz-Reuter-Grundschule in Kühlungsborn groß geschrieben. Auf der ersten Seite der Umweltzeitung ist das neue Logo der Bildungseinrichtung abgebildet. Monika Paulicks erklärte mir, der große Baum in der Mitte des kreisrunden Signets stehe dafür, dass sich die Grundschule am Waldesrand befände. Daneben seien eben die Naturverbundenheit und die vielen Aktivitäten zum Thema Umwelt und Natur damit versinnbildlicht. Drei Möwen im Baum würden auf das Wappen von Kühlungsborn verweisen und warum man den Kreis als Form wählte, dazu hatte Tim Bachnick schon vor längerer Zeit eine ganz tolle Erklärung, sagte mir die ehemalige Schulleiterin Monika Paulicks. „Das bedeutet: Wir sind eine feste Gemeinschaft und halten zusammen“, sagte er einst. Bevor es nun aber endlich zur Auszeichnung des 13. Schülerprojektwettbewerbes kam, hielten noch der Amtsleiter des StAUN Rostock, Hans-Joachim Meier, der Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock, Roland Methling und Dr. Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V ihre Grußworte. Hans-Joachim Meier bedankte sich bei allen Partnern und Sponsoren des Wettbewerbs sowie den Organisatoren der Veranstaltung. Roland Methling freute sich darüber, dass viele Projekte sich „auch mit dem, was unsere Region ausmacht, nämlich dem Thema Wasser“ befassen. Dann gab er zu, er habe noch nicht gewusst, dass aus einem Kilo Holz neun Schulhefte und aus Altpapier achtzehn Schulhefte entstehen können. Auch der Oberbürgermeister hat also heute viel Neues entdecken können. „Da wird Einem warm ums Herz, wenn man sieht, was hier passiert und wie viel Hoffnung in den jungen Menschen für unser Land steckt“, sagte er abschließend. Dr. Till Backhaus verlieh seiner Begeisterung über das Engagement der Schüler und Lehrer Ausdruck. Der Schülerprojektwettbewerb habe das Ziel „Schüler StAUNen zu lassen“, so der Minister. Dann sprach er über den drohenden Klimawandel, den Lebensraum Ostsee, den Wissensdurst der Jugend, die gerade drohende Hochwasserflut in Brandenburg, die Niedermoore Mecklenburg-Vorpommerns, das Rostocker StAUN, die Artenvielfalt unseres Bundeslandes, die Glückszahl 13, die gerade wunderschön blühenden Rapsfelder, den Gewässerreichtum Meck-Pomms und regenerative Energien. Er betonte auch den Vorteil, den der Verbrauch regionaler Produkte für die Umwelt mit sich bringe. 498 Schülerinnen und Schüler hätten am Wettbewerb insgesamt teilgenommen und eigentlich hätten alle etwas daraus gewonnen und sich für unsere Region eingesetzt, verriet er zum Abschluss. Anschließend ging es an die Ehrung der Preisträger des 13. Schülerprojektwettbewerbes „Schüler StAUNen …“. Als Zweites wurden die Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe „Schülerzeitung“ der Klassen 3 und 4 des Schuljahres 2008/2009 von der Fritz-Reuter-Grundschule in Kühlungsborn mit einem Preis des StAUN Rostock ausgezeichnet. Dr. Till Backhaus und Hans-Joachim Meier überreichten eine Urkunde und beglückwünschten die Preisträger. Neben ihnen hatten 14 weitere Projekte Preise erhalten. Die Freude über die Anerkennung ihrer Leistung war natürlich bei allen Preisträgern groß. Neben den Schülern stellten an diesem Tag weitere regionale Akteure ihre Aktivitäten in Sachen Klimaschutz im Rathausfoyer vor. An den Informationsständen des Europäischen Integrationszentrums Rostock e.V, der Organisatoren der Energiesparkampagne „Change – Energiebewusst Handeln“ an der Universität Rostock, des ADFC Rostock, des StAUN Rostock als Praxispartner im RADOST-Projekt, der Klimaschutzleitstelle der Hansestadt Rostock sowie der Neuen Verbraucherzentrale konnte ich viel Wissenswertes in Erfahrung bringen. Darüber hinaus war die Ausstellung „Klima schützen kann jeder“ der Neuen Verbraucherzentrale äußerst informativ und eine echte Bereicherung für die Veranstaltung. Am Ende hatte ich eine Menge an Broschüren und Flyern zum Thema Klimaschutz in meinem Rucksack und viele Wissenslücken diesbezüglich in meinem Kopf geschlossen. So wird es Vielen ergangen sein – ein durch und durch gelungener Aktionstag.
27. Mai 2010 | Weiterlesen
Anfüttern für die 12. Klassik-Nacht im Zoo Rostock
Nur noch drei Tage bis zur 12. Klassik Nacht im Rostocker Zoo. Höchste Zeit für den Dirigenten Uwe Theimer, sich mit den Besonderheiten des Konzerthauses vertraut zu machen. Am 28. Mai will der Österreicher mit der Norddeutschen Philharmonie hier „Donau Klänge“ präsentieren. Heute geht er schon mal mit den beiden Binturong-Brüdern Abang und Banu auf Tuchfühlung. „Angst habe ich nicht“, sagt er gelassen, bevor er das Gehege in der Nähe des Veranstaltungsplatzes betritt: „Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen.“ Als er dann zwischen den beiden Marderbären steht, wird deutlich, dass das Dirigieren seine Profession ist. Nur hat er heute statt seines Taktstockes und eines Orchesters eine Banane und zwei Binturongs, die ihm folgen. Unterstützt wird er dabei von Kuratorin und Leiterin der Tierpflege Antje Zimmermann. Sie erklärt auch den Zusammenhang zwischen der Wahl der Tiere und dem Thema des Konzerts: „Geografisch betrachtet, gibt es nicht viele Gemeinsamkeiten. Die Binturong stammen nicht aus Europa, sondern aus Asien. ,Donau Klänge‘ kann man vielleicht mit Kaffeehausatmosphäre in Verbindung bringen. Es gibt eine verwandte Schleichkatzenart die Kaffeebohnen frisst. Wenn diese wieder ausgeschieden werden, wird daraus sehr wertvoller Spitzenkaffee hergestellt.“ Uwe Theimer, der seine musikalische Ausbildung bei den Wiener Sängerknaben sowie der Akademie für Musik und darstellende Kunst Wien erhielt und bereits auf allen Kontinenten Konzerte dirigiert und begleitet hat, will auch bei der Gestaltung des Programms seine Spezialität die Wiener Musik und die Zoologie miteinander verbinden. So können sich die Besucher der Klassik-Nacht auf drei Polkas mit den Titeln „Die Biene“, „Die Libelle“ und „Tarantel-Galopp“ freuen. Außerdem wird der Walzer „Die Schönbrunner“ von Lanner erklingen. „Der Wiener Zoo in Schönbrunn ist der älteste Zoo der Welt“, erläutert Uwe Theimer seine Entscheidung. Neben den bekannten Walzermelodien der Familie Strauss werden auch die Komponisten der Wiener Klassik nicht fehlen. So wird die Norddeutsche Philharmonie Rostock auch Werke von Mozart, Beethoven und Haydn vortragen. Die Erlöse aus der Klassik-Nacht kommen dem Darwineum mit der neuen Menschenaffenanlage des Zoos zugute. Ziel ist es unter dem Motto „Schaffen für die Affen“ bis 2012 ein neues Zuhause für die drei Orang-Utans Saba, Sunda und Assumbo zu bauen. Karten gibt es noch an den Vorverkaufskassen. Auch bei nassem Wetter ist für die Konzertbesucher gesorgt. Im Anschluss der „Donau-Klänge“ beginnt eine Mondschein-Expedition durch den nächtlichen Zoo.
26. Mai 2010 | Weiterlesen
„Rallye Fernost“ im Marine Science Center
Noch ist es ruhig im Marine Science Center im Yachthafen Hohe Düne an diesem Nachmittag. Die Seehunde genießen die Sonne oder schwimmen entspannt um den Ausflugsdampfer „Lichtenberg“ herum, der zu einer Robbenforschungsstation umgebaut wurde. Kurze Zeit später nähert sich eine Gruppe junger Leute von der Mole. Es sind die Nachwuchsjournalisten Anaïs, Janina, Katharina, Kimberly, Laura und Pascal. Alle stammen aus den alten Bundesländern und wollen nun mithilfe der „Hochschulinitiative Neue Bundesländer“ auf der „Rallye Fernost“ die Hochschulen in Mecklenburg Vorpommern und Brandenburg erkunden und darüber berichten. Dafür haben sie sich erfolgreich mit kreativen Texten und Videos um einen Platz im Rallye-Team beworben. Nun stehen sie als „Team Rot“ im Wettstreit mit drei weiteren Teams, deren Entdeckungstour durch die Neuen Bundesländern parallel startet. Die erste Station für das Team Rot ist die Universität Rostock. Nachdem am Vormittag schon ein Interview abgedreht wurde, steht nun „Wettrobben“ auf dem Plan. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Professor Dr. Guido Dehnhardt, Leiter der Forschungseinrichtung: „Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie sich Meeressäuger, vor allem Seehunde, orientieren. Wir erforschen ihre Sinnessysteme und Informationsverarbeitung.“ In einem Experiment sollen die 16- bis 20-jährigen Schüler anschließend die hydrodynamische Spurenverfolgung der Seehunde kennenlernen. Ausgestattet mit Neoprenanzügen geht es dafür ab ins Wasser zu den Tieren. Vorher gibt es noch eine Einweisung durch die Biologin Nele Gläser: „Seehunde sind Raubtiere. Wie Hunde können sie beißen. Aber wenn ihr die Tiere nicht beunruhigt, wird nichts passieren.“ Als Erstes sind Pascal und Anaïs an der Reihe. Das 10 Grad Celsius kalte Wasser löst bei ihnen einen kleinen Schock aus, aber schnell verharren sie regungslos und warten auf den Seehund Henry. Alles wird für das Experiment vorbereitet. Nele Gläser stülpt dem Seehund Henry eine Maske und Gehörschützer auf. So kann er nicht sehen und hören, wie der Physiker Lars Miersch unter Wasser eine Spur zu einem der Fernostreporter legt, die der Seehund anschließend nur mithilfe seiner hochsensiblen Barthaare verfolgen soll. Das Experiment funktioniert. Die Teilnehmer sind begeistert, der Seehund auch. Bevor die beiden aus dem Wasser steigen, verteilt Henry noch einen dicken Knutsch an Pascal und Anaïs. „Das war richtig, richtig cool“, schwärmt die Zehntklässlerin aus Niedersachsen: „Eine wirklich besondere Erfahrung.“ „Und wie war der Knutsch?“ fragt die Kamerafrau vom Team, die alles aufzeichnet. „Ja, aus Henry ist zwar kein Prinz geworden, aber ich würde ihn trotzdem mitnehmen. Platz in der Badewanne gibt es noch“, lacht Anaïs. Auch für Pascal aus Nordrhein-Westfalen ist es ein ungewöhnliches Erlebnis. Trotzdem kommt ein Biologiestudium für ihn wohl nicht in Frage. Biochemie ist nicht so sein Ding. Er sieht seine berufliche Zukunft im Bereich der Medien. Sein Traum wäre es Filmregie zu studieren, vielleicht sogar in Potsdam. Für ihn sind die ostdeutschen Hochschulen wegen ihres interessanten Studienangebots reizvoll. „Ein großer Vorteil ist auch, dass keine Studiengebühren erhoben werden“, weiß der 20-Jährige. In den nächsten Tagen werden die sechs Nachwuchsjournalisten noch Gelegenheit haben die Fachhochschulen in Stralsund und Eberswalde zu begutachten. Ihre Erlebnisse können Internetnutzer auf der Website http://www.studieren-in-fernost.de/rallye/ mitverfolgen und für das beste Team abstimmen. Am Samstag findet schließlich die Abschlussveranstaltung in Potsdam statt, wo alle Teilnehmer der „Rallye Fernost“ aufeinandertreffen und das beste Team gekürt wird.
26. Mai 2010 | Weiterlesen
Kurkonzert im Kurgarten Warnemünde
Der Himmel über Rostock war am Pfingstmontag ziemlich bedeckt. Am Vormittag hatte es sogar geregnet. Sehr gemütlich und frühlingshaft war das nicht. Dennoch sattelte ich mein Pferd, „ähm“ Fahrrad, und machte mich so gegen 14 Uhr auf die Hufen, „ähm“, fuhr damit nach Warnemünde. Ich war schon losgefahren, da fiel mir auf, dass ich meinen Regenschirm vergessen hatte. Einen solchen sollte ich aber wohl dabei haben, dachte ich. Man weiß ja nie. Gerade regnete es zwar nicht. Aber es sah so aus, als würde es das ganz sicher bald tun. Also, „kehrt marsch“ und Schirm geholt. Für alle Fälle gewappnet, betrat ich kurz vor 15.30 Uhr den Kurgarten. Ach ja, ich hab ja noch gar nicht erzählt, was ich da überhaupt wollte. Ein pfingstfröhliches Kurkonzert wollte ich mir natürlich genehmigen. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lippspringe (Westfalen) hatte sich angekündigt. Au ja, wie lange hatte ich schon keine Blasmusik mehr gehört? Wie ich dachten wohl nicht viele, vor allem bei dem Wetter. Jedenfalls zählte ich neben mir kaum vier Personen auf den Zuschauerbänken vor der Bühne des Kurgartens. Die Blasmusikanten ließen sich davon nicht beirren und legten trotzdem pünktlich los. Als erstes spielten sie ein von Jacob de Haan komponiertes Stück, das die Stilrichtungen des Barock, Pop und Jazz vereint. Das war ein schwungvoller Auftakt. Danach begrüßte Christian Landerbarthold stellvertretend für den gesamten Musikzug alle Zuhörer. Er führte mit seinen Erläuterungen durch die gesamte musikalische Veranstaltung. So kündigte er auch das zweite Stück „Antonins new world“ an. Es werde in Anlehnung an Antonin Dvořáks Wirken in der neuen Welt Amerika gespielt, verriet der freundliche Blasorchester-Moderator aus Bad Lippspringe. Auch das Stück gefiel mir sehr. Außerdem füllte sich der Kurgarten so langsam mit weiteren Zuhörern. Die Musik lockte sie aus allen Richtungen heran. Gute Laune machte sich breit. Manch einer wippte im Takt hin und her. Einige Kinder sah ich gar fröhlich beschwingt zur Musik herum hüpfen. Der Musikzug kommt, wie sein Name verrät, aus Bad Lippspringe. Das liegt in Ostwestfalen und ist eine Kurstadt in der Nähe von Paderborn. Seit über hundert Jahren gibt es das Blasorchester schon. Derzeit besteht es aus etwa fünfzig Musikern. Vierzig davon erlebte ich im Kurgarten. Eine Konzerttournee führte sie zu Pfingsten an die Ostseeküste. Wie ging es aber nun weiter im Programm? Ich hörte noch ein Medley britischer Sea-Songs von Henry Wood, den Graf-Zeppelin-Marsch und drei Songs von Eric Clapton. Währenddessen zog sich jedoch der Himmel immer weiter zu und es wurde immer dunkler und ungemütlicher in Warnemünde. Aus diesem Grund verschwand dann ein Hörer nach dem anderen. Und es musste ja so kommen. Dann fing es auch noch an zu regnen. Jetzt saßen ich und eine einzige weitere tapfere Person ganz allein vor der Bühne. Und wir konnten unsere Stellung auch nur halten, weil wir beide unsere Regenschirme nicht zu Hause hatten liegen lassen. Das musikalische Programm auf der Bühne wurde fortgesetzt. Der Regen prasselte auf meinen Schirm und ich überlegte, ob ich den Heimweg antreten sollte. Doch irgendetwas hielt mich noch zurück. So lauschte ich dann der Titelmelodie des Louis de Funès – Films „Der Gendarm von Saint Tropez“ und einem Abba-Medley mit Songs, wie „Dancing Queen“, „Money Money“ und „Mama Mia“. Anschließend gab es eine fünfzehn-minütige Pause. Auch jetzt noch hörte es nicht auf zu regnen. Die zweite Hälfte des Kurkonzertes begann schwungvoll mit dem modernen Marsch „Step out and Swing“, der Swingrhythmen und Blueselemente verbindet. „Hab ich eigentlich schon die Dirigentin Sabine Bunte vorgestellt?“, fragte der Moderator plötzlich. Hatte er noch nicht. Bis eben. Seit 1989 ist sie Mitglied im Musikzug und dirigiert ihn seit 2000. Man spielte noch ein Medley des „erfolgreichsten Bandleaders der Welt“, wie Christian Landerbarthold verriet. Es handelte sich um den Liederreigen „James Last – Golden Hits“. Eil der weil passierte, womit wohl keiner der Anwesenden mehr gerechnet hätte. Die Wolkendecke lockerte sich allmählich auf, man sah hier und da ein kleines Stück blauen Himmel und da war sie, die Sonne. Nun erstrahlte sie in vollem Glanze und erfreute alle mit ihrer wärmenden Kraft. Daraufhin erschienen auch wieder zahlreiche große und kleine Hörer und lauschten den heiteren Klängen. Ich war mir sicher, die Musikanten des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lippspringe hatten die Wolken mit ihrer rhythmischen wie auch ausdauernden klang-künsterischen Tatkraft hinfort musiziert. Während ihrer letzten Stücke ward die Bühne in goldgelbes Licht getaucht. Das waren „Selections from Starlight Express”, ein spanischer Paso Doble und das Medley “Italo-Oldies”. Mit dem Medley „Spirit of sixty-nine“ beendete das Blasorchester seinen Auftritt. Dabei klatschte das Publikum zum Takte der Musik. Wenn sich auch die Sonne erst verspätet durch die Wolken gekämpt hatte, es war ein heiteres Nachmittagsprogramm, das viele Warnemünder Gäste erfreute. Vielleicht kommen die Blasmusikanten ja irgendwann noch einmal zu uns in den Norden und hoffentlich hat es ihnen hier gefallen. Ich hatte in den letzten Wochen schon so einige musikalische Veranstaltungen besucht. Auch diese bereichert meinen musikalischen Erfahrungsschatz. Auf dem Heimweg ließ ich mir die Sonne ins Gesicht scheinen und pfiff noch das eine oder andere soeben gehörte Lied vor mich hin.
25. Mai 2010 | Weiterlesen
„Kunst offen“ in Rostock
Pfingsten und die Aktion „Kunst offen“ gehören in Mecklenburg Vorpommern zusammen und das nun schon seit 15 Jahren. Ich erinnere mich gern, wie wir früher bei schönstem Frühlingswetter mit dem Rad über die Dörfer fuhren zu den Ateliers der bildenden Künstler, die in der Abgeschiedenheit der ländlichen Idylle ihrem Metier nachgehen. In diesem Jahr will ich den Künstlern in Rostock über die Schultern schauen. So versprechen es zumindest die Organisatoren vom Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin e.V. und vom Verband Mecklenburgische Ostseebäder e.V. Es ist Pfingstsonntag. Die Sonne lacht wärmend vom fast wolkenlosen Himmel, ideales Strandwetter. Ich beschließe, nach Warnemünde zu fahren. Dort sind auf dem Informationsblatt der Aktion zwei Anlaufpunkte verzeichnet. Zuerst geht es in die Galerie Möller. Schon von Weitem erkenne ich sie an dem gelben Kunst-offen-Schirm über der Tür. Zu sehen sind Grafiken von Helena Bergenrud und Keramiken von Antje Halter. „Kann man denn den Künstlern hier auch über die Schultern schauen?“ frage ich den Mann am Tresen. „Nein unsere Künstlerinnen kommen aus Schweden und Halle. Wir stellen nur ihre Werke aus. Hier sind sie jedoch nicht.“ Schade. Mein nächstes Ziel ist als Atelier ausgewiesen. Ob ich hier einen Künstler an seiner Arbeitsstätte finden kann? Als ich in der Tür stehe, werde ich darüber informiert, dass es keine Ausstellung gäbe und dass man sich im Haus auch nicht erklären könne, warum sie im Programm für Kunst offen auftauchen. Also wieder kein Künstler. Ich mache mich enttäuscht auf den Heimweg. Als ich über die Brücke am Alten Strom schlendere, entdecke ich Svetlana Shanurenko. Sie hat ihre Pinsel und Farben ausgepackt, um ihre Eindrücke vom Warnemünder Treiben auf Papier zu bringen. Neben ihr liegen ein paar ihrer Aquarelle, auf denen vor allem Landschaften abgebildet sind. Endlich habe ich eine Malerin gefunden und ganz offen unter freiem Himmel. Am nächsten Tag, Pfingstmontag, nehme ich mir die Rostocker Innenstadt vor. Eine dicke Wolkendecke hat sich über die Stadt gezogen aus der leichter Regen fällt. Beim Lesen des Kleingedruckten im Programmheft bemerke ich, dass am letzten Tag der Aktion Kunst offen in der Rostocker Innenstadt gerade mal eine Ausstellung geöffnet ist. Im Wittespeicher können zwölf macrophotographische Exponate ohne Rahmen betrachtet werden, die im Jahre 2002 für eine Ausstellung zum Thema Microkosmos einer Glasperle entstanden sind. Die Künstlerin selbst bleibt unbenannt und ungesehen. Trotz Regen laufe ich weitere Ateliers, Werkstätten und Galerien ab. Doch überall sind die Türen geschlossen. Als ich in der Bahnhofstraße an der Tür der Porzellanwerkstatt von Petra Benndorf klingel, wird mir unerwartet geöffnet. Ich darf eintreten in eine wunderschöne Ausstellung mit Malereien von Grit Sauerborn und Objekten und Gefäßen aus Porzellan von Petra Benndorf. In der oberen Etage kann ich mir sogar den Arbeitsplatz anschauen. Ich erkundige mich, ob man die Künstlerin in den letzten beiden Tagen an der Drehscheibe beobachten konnte. „Nein,“ lautet die Antwort: „Wir hatten so viele Besucher hier. Das wäre gar nicht möglich gewesen.“ Nachdem ich mir alles anschaut habe, wird mir empfohlen zum Alten Markt zu gehen. Dort hätte eine Galerie ganz neu eröffnet und befände sich deshalb noch gar nicht auf der gedruckten Kunst-offen-Liste. Gesagt, getan, auf zur „galerie marjungfru“. Hier erlebe ich nun alles so, wie ich es mir vorgestellt habe: die Tür ist offen und das Ambiente einladend. Von acht Künstlern wurde eine vielfältige Sammlung zusammengetragen, unter anderem Malerei, Grafik und Buchillustrationen von Klaus Gumpert, Schmiedekunst von Marcus Grosser, Keramik von Tom Giertz, Porzellan und Keramik von Tonio Schmidt, Kerzendesign von Manuela Werk und Ölmalerei von Marko Bennin. Ein Künstler ist sogar selbst anwesend. Tino Langrock zeigt seine Malereien, Unikatschmuck und Skulpturen. Er hat gerade darüber nachgedacht zu schließen. Aber nun holt er doch noch seine schwedische Schnitzaxt heraus, stellt seinen Sägebock nach draußen und zeigt mir, wie er an seinen Holzfiguren arbeitet. Inzwischen sind weitere Besucher in die Galerie gekommen. Bei einem Kaffee plaudern sie mit dem Künstler über die Ausstellungstücke. Es sind Kenner. Sofort identifizieren sie die Glasarbeiten von Andre Max Werner Blumberg aus Kühlungsborn. „Diese Stücke wurden extra für uns angefertigt. Wir möchten das Besondere ausstellen,“ erklärt Tino Langrock. Ja, hier kann man wirklich auf Kunst und Künstler zugehen, das Schöne und Ungewöhnliche betrachten und in einer kreativen Umgebung mit dem Kunstschaffenden ins Gespräch kommen. Das ist „Kunst offen“. Als ich die Galerie verlasse und mich auf den Heimweg mache, hat der Regen aufgehört und die Abendsonne streckt noch einmal ihre Strahlen durch die ziehenden Wolken.
25. Mai 2010 | Weiterlesen
„Luv un Lee“ und Kathy Kelly in der KTV
Am Freitag wurde ich in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt Zeugin eines musikalischen Zusammentreffens der besonderen Art. Kathy Kelly, die viele Jahre lang Produzentin und Sängerin der erfolgsgekrönten Familiencombo „The Kelly Family“ war, musizierte gemeinsam mit dem Rostocker Shanty-Chor „Luv un Lee“ in der Heiligen-Geist-Kirche. Als ich diese erreichte, war sie schon recht gut gefüllt und ich hatte großes Glück, noch einen Platz in der ersten Reihe erwischen zu können. „Grande Dame of Gospel and Folk“ wird sie genannt. Kathy Kelly wurde 1963 in Massachusetts geboren und fand fünf Jahre später in Spanien eine neue Heimat. Als sie 15 Jahre alt war, begann ihre Familie die Laufbahn als Straßenmusiker. Die Kellys entwickelten sich zur weltbekannten Kultband. Ihr Album „Over the Hump“ war in Deutschland die meistverkaufte Platte aller Zeiten. Derzeit befindet sich Kathy auf ihrer „Gospel-European Tour“. Diese führte sie auch nach Rostock. Gospelsongs und Seemannslieder, ob das zusammenpasst? Von langen Reisen, harter Arbeit, Liebe und der Sehnsucht nach der Heimat erzählen jedenfalls Shantys wie auch Gospelsongs. Und dass diese Genres sehr wohl miteinander harmonieren, konnte ich an diesem Abend selbst erleben. Zuvor hatte ich mich noch ein wenig zu gedulden. Die Tür im Chorbereich, der zur Bühne umfunktioniert worden war, ging ab und an auf. Dann stiefelten aber immer nur Tontechniker oder andere wichtige Konzert-Organisations-Management-Leute hindurch. Sie warfen einen verstohlenen Blick auf das Publikum, redeten mit anderen wichtigen und ebenfalls sehr beschäftigten Menschen und stimmten Musikinstrumente. Ich wurde schon richtig ungeduldig, da traten die Chorsänger von „Luv un Lee“ endlich vor ihr Publikum. Und was war das für ein Auftritt! Während sich der Chor noch positionierte, trat einer der Sänger in den Vordergrund und läutete feierlich den Beginn des Abendprogramms an der „Luv un Lee“-Glocke ein. Dann färbte sich der gesamte Chorbereich rot und die Matrosen von „Luv un Lee“ stimmten ihr erstes Lied an. Die Shanty-Truppe gibt es schon seit 1981. Damals wurde sie vom VEB Fischkombinat Rostock gegründet. Seit 1990 werden ihre Lieder im NDR und auf weiteren Sendern ausgestrahlt. Zwei Tourneen durch die USA haben sie erlebt und sie sangen 1999 im Rahmen eines Sommerfestes zum Ende der Amtszeit des einstigen Bundespräsidenten Roman Herzog auf Schloss Bellevue. Ihr Repertoire umfasst Shantys, Seemannslieder, maritime Evergreens, Heimat- und Scherzlieder sowie weihnachtliche Lieder. Diese singen sie auf hochdeutsch, englisch und „up platt“. Nun aber zurück zum Konzert. Ihr zweites Lied an diesem Abend war „Gelbe Rose von Texas“. Es ist von Seeleuten aus Amerika nach Europa gebracht worden und handelt von Liebe und einem schönen Mädchen. Das nächste Lied, „Sailing“, bezog sich auf den Augenblick an Bord eines Schiffes, indem die optimistische Stimmung der Seefahrer in Sehnsucht nach zu Hause umschlägt. „So mancher Sturm wird wehn, bis wir uns wiedersehn“, sangen „Luv un Lee“. Der Klang ihrer Stimmen ertönte in der Kirche noch eindrucksvoller als an anderen Orten. Die Heiligen-Geist-Kirche schien mir der rechte Ort zu sein, um diesen phantastischen Sängern noch mehr Klangraum zu geben. Die Wirkung ihrer Darbietung steigerte sich dadurch sehr. Nach dem fünften Lied trat der Shantychor zunächst ab, um dem Star des Abends Freiraum auf der improvisierten Bühne zu gewähren. Kathy Kelly nahm diesen dankend an. Nach nur kurzer Begrüßung des Publikum stimmte sie den Opener „Who´ll Come With Me“ an. Dabei begleitete sie der Keyborder Andreas Recktenwald. Beide wussten das Publikum in Handumdrehen zu begeistern. Neben gefühlvollen Balladen stimmten sie auch stimmungsgeladene und heitere Songs an. Kathy erwies sich bei der Performance als absolute Multiinstrumentalistin. Spielte sie eben noch Akkustikgitarre, griff sie beim nächsten Song schon zum Akkordeon. Neben englischsprachigen Titeln erklangen auch deutsche und spanische. Bei Letzteren musste ihr besonders warm ums Herz geworden sein, denn sie erwähnte anschließend ihre glücklichen Erinnerungen an ihre Kindheit in Spanien. Nun folgte eine Pause. Danach trat erneut der Shantychor vor die Mikrophone. Die „Islandfischer“, ein altes flämisches Fischerlied, eröffnete von neuem den maritimen Liederreigen. Nach dem „Samoasong“ und einigen weiteren gab der Chor das „Seemannslied-Medley“ zu Gehör. Die Zuhörer klatschten dabei im Takte. Bei solch guter Stimmung ließen es sich beide, der Chor und Kathy Kelly, nicht nehmen, zum Höhepunkt dieses Konzertes gemeinsam aufzutreten. Bei Evergreens, wie „La Paloma“ oder „Rolling Home“, konnten sie ihr ganzes Können vereinen. Die Hörerschaft geriet dabei ganz aus dem Häuschen. Am Ende der Veranstaltung waren sowohl „Luv un Lee“, Kathy Kelly wie auch das Publikum dankbar für diesen gelungenen Abend. Als besonderen Abschluss darf auch Kathys Resümee verstanden werden, dass Rostock ihrer Meinung nach vor zwanzig Jahren schon eine liebenswerte und schöne Stadt gewesen, heute aber noch viel schöner sei.
24. Mai 2010 | Weiterlesen
25. An-Bagger-Cup am Warnemünder Strand
Nachdem der Inchez-Cup wegen Dauerregens am vorigen Wochenende abgesagt werden musste, ruhten nun alle Hoffnungen auf dem Pfingstwochenende, um mit dem An-Bagger-Cup und dem MUMien-Cup in die Warnemünder Beach-Volleyball-Saison zu starten. Der Samstag verhieß nichts Gutes. Dichter Nebel hatte sich über den Strand gelegt. Die Temperaturen waren entsprechend kühl. Der Leuchtturm verschwand im Dunst und von der Warnow dröhnten unablässig die Hörner der Schiffe, die sich ohne Sicht zurechtfinden mussten. Aber die Beachvolleyballer, die aus dem ganzen Norden Deutschlands angereist waren, trotzten den widrigen Bedingungen am Samstagmorgen. 24 Felder wurden aufgebaut. 144 Zweier-Mannschaften traten gegeneinander an, in gemischten Teams natürlich – es handelt sich ja schließlich um einen An-Bagger-Cup. Es durfte sich also nicht nur beim Volleyball von unten zugespielt, sondern auch ausdrücklich geflirtet werden. Um den Bedürfnissen beider Geschlechter beim Spiel gerecht zu werden, wurden die Netze auf eine Höhe von 2,35m eingestellt, ein fairer Kompromiss. Außerdem galt es noch einen Ehrenkodex zu beachten, nachdem die Frau über die Frau spielen muss bzw. der Mann über den Mann, um Zweikämpfe möglichst gleichgeschlechtlich zu halten. Na ja, daran konnte sich im Eifer des Gefechts nicht immer gehalten werden. Manchmal sahen die Herren beim Angriff der Damen ganz schön alt aus. Ein Spieler entwickelte eine derartige Dynamik, dass er mit einem Sprung gleich zwei Volleyballnetze niederriss. Dank des Organisationsteams von Active Beach e.V. wurden sie schnell wieder aufgerichtet und die beiden Partien konnten weitergespielt werden. „Zunächst wird in den 24 ausgelosten Vorrundengruppen mit jeweils sechs Teams gespielt, ehe es dann je nach der Platzierung für die Mannschaften in den A-, B- oder C-Cup geht“, erläuterte Steffen Bock, Leiter des Turniers, den Ablauf: „Die besten Mannschaften spielen dann bis zum Sonntagnachmittag den Turniersieg aus.“ Am Sonntag war dann schließlich alles wieder gut. Strahlende Sonne, blauer Himmel – bei bestem Beachvolleyballwetter konnten schließlich nach den letzten Zwischenrunden bei den 16ern Double Outs die Sieger ermittelt werden. Die Hamburger Swantje Basan und Marian Heldt mussten sich im Finale des A-Cups den Lokalmatadoren Henrike Höft und Frank Thiesenhusen geschlagen geben. Stefanie Kelm und Christopher Fischer besiegten im kleinen Finale Sandra Gutsche und Toni Mester. Den ersten Platz im B-Cup gewannen Frauke Söhler und Jens Weschenfelder und über den Sieg im C-Cup konnten sich Kristin Schnittger und Sebastian Kluth freuen. Die nächste Chance beim An-Bagger-Cup anzutreten gibt es am 7. und 8. August während der Hanse Sail 2010. Alle Ergebnisse des Turniers gibt es hier.
24. Mai 2010 | Weiterlesen
Anna Vynogradova: „BLICKE“
Dieses leckere Büfett erwartete mich am Mittwochabend beim Rostocker Frauenkulturverein „Die Beginen e.V.“ im Heiligengeisthof 3. Salzige und süße Kekse, Obst, Wein, Sekt, Wasser und Tee begrüßten alle Gäste der Ausstellungseröffnung BLICKE und warteten darauf, endlich vernascht zu werden. Ich gönnte mir die eine oder andere Köstlichkeit und warf einen ersten BLICK auf die Kunstwerke Anna Vynogradovas. Die Künstlerin wurde 1974 in der ukrainischen Stadt Charkow geboren. Dort studierte sie bis 2006 Bildhauerei. Ein Jahr später zog sie nach Deutschland. Seit dem vergangenen Jahr absolviert sie ein Fernstudium in der Ikonenmalerei. In der Ausstellung BLICKE werden Acrylmalereien, Zeichnungen und eine Ikone von Anna Vynogradova gezeigt. Der Titel der Werkschau ist Programm. Es sind BLICKE, die dem Betrachter der Kunstwerke begegnen. Ein Acryl-Gemälde zeigt das Auge eines Pferdes. Steht man davor, zieht es einen magisch an. Man versinkt in diesem tiefdunklen Auge. Gleichzeitig schaut es den Betrachter an. Tier und Mensch kommunizieren scheinbar miteinander. Doch was könnte ich der Kreatur wirklich mitteilen? Was weiß sie über mich? Ein Zyklus von Zeichnungen mit dem Titel „Mascha“ zeigt eine junge Frau. Auch sie blickt aus dem Bild heraus und schaut den Betrachter an. Was erfährt er über sie? Ihre Gesichtszüge sagen mehr als tausend Worte. Franziska Roeber eröffnete die Abendveranstaltung mit dem dritten Satz einer „Suite in h-Moll“ von Jean Daniel Braun auf der Querflöte. Sie studiert derzeit Theologie in Rostock. Dann führte die Kuratorin der Ausstellung, Daniela Boltres, die Anwesenden in das Werk Anna Vynogradovas ein. Sie erklärte, dass das Bild „Nophretete aus Rostock“ eine Auftragsarbeit gewesen sei. Es zeige eine Frau aus Rostock, wie sie sich selbst sieht. Oberhalb einer Wüstenlandschaft erscheint am Firmament ihr Portrait in Gestalt der Nophretete. Daniela Boltres: „Sie stellt sich in eine kulturell akzeptierte, verehrungswürdige ästhetische Tradition“. Das führe dazu, dass sie sich dem Heute entrücke. Anschließend wandte sie sich der Ikonenmalerei Anna Vynogradovas zu. Ikonen, das sind Heiligenbilder. Sie sind kirchlich geweiht und sollen eine Verbindung zwischen dem Betrachter und dem Dargestellten, indirekt auch zwischen dem Betrachter und Gott sein. Die Kuratorin erläuterte, dass sich die „religiöse Gestimmtheit der Malerin“ in den Ikonen offenbare. Bestandteil der Ausstellung ist ein Abbild der heiligen Xenia, einer Frau, die im 18. Jahrhundert in St. Petersburg lebte und wirkte. Sie setzte sich zeit ihres Lebens unermüdlich und selbstlos für die Armen und Hilfsbedürftigen der Stadt ein. In den Ikonen werde Göttliches transparent, sagte Daniela Boltres und sprach von den „von Gott berührten“. Diese hätten einen veränderten BLICK auf die Welt. „Es sind diese BLICKE, mit denen die Ikonen den Himmel aufreißen und in den wir auch mit der Malerin hineinschauen können“, führte sie aus. Anna Vynogradova hatte eine kleine Ikonenwerkstatt mit in die Ausstellung gebracht. Neben noch unvollendeten Ikonen, Übungsstücken, Farben, Pinseln und einem kleinen Strauß verschiedenfarbiger Blumen, waren da Kataloge und Bildbände zur Ikonenmalerei auf einem kleinen Tisch verteilt. Nachdem nun Franziska Roeber den ersten Satz der „Fantasia in fis-Moll“ von Georg Philipp Telemann gespielt hatte, lud die Künstlerin selbst zu einem Gespräch in die kleine Ikonenwerkstatt ein. Da erfuhr ich dann, was Anna Vynogradova so sehr an der Ikonenmalerei fasziniert. Zum einen sei das die Tatsache, dass auf dem kleinen Raum der Ikone Komponenten aus der gesamten Welt versammelt seien. Tierische Bestandteile, wie etwa Eier, aber auch Mineralien und verschiedene Pigmente seien das. Diese Pigmente stammen aus dem Baikal, aus Sachsen und vielen anderen Orten auf der ganzen Welt. Die Farben werden also selbst angemischt. Interessant sei überdies der Verlauf der Linien in einer Ikone. Auf einer Vorstudie der Ikonenmalerin war das besonders deutlich zu erkennen. Alle Linien scheinen auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden zu sein. So wandern die Augen des Betrachters den Linien folgend über das gesamte Abbild und versenken sich darin. „Das ist eine Technik, die man tausende Jahre lang verbessert hat“, so die Ikonenmalerin. Ob es da eine bestimmte Formensprache und feste Regeln gäbe, wurde Anna Vynogradova gefragt. „Ja“, antwortete sie, „alles hat Bedeutung“. Wenn beispielsweise eine Figur auf einem Felsen stehend abgebildet sei, dann stehe dieser Felsen sinnbildlich für die bereits vollzogene und erfolgreiche Mühe und Arbeit auf dem Weg zu Gott. Auch die Farben, die Positionen der Figuren und die Hintergrundmotive seien vorgeschrieben. All dies trage Bedeutung. Und kann man nicht auch gegen diese Regeln verstoßen? Nein, das wolle man auch gar nicht, erklärte sie. Entscheiden könne man, welchen Farbton man wähle. Fest stehe aber: „Ikonen malt man nicht. Ikonen lassen sich malen“. Außerdem sei der Schaffensprozess auch immer ein Dialog und die Künstlerin befinde sich damit in einem Gespräch, erklärte sie. Um Kommunikation geht es Anna Vynogradova also in ihrer Kunst. Das ist auch der Grund, warum ihr BLICKE so wichtig sind. BLICKE sind „immer eine Einladung zur Kommunikation“, erzählte sie einst Daniela Boltres. Diese Einladung wird in der Ausstellung BLICKE, die es ab sofort in den Räumlichkeiten des Rostocker Frauenkulturvereins „Die Beginen e.V.“ zu erBLICKEn gibt, auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht. Die Ausstellung bildet übrigens den Auftakt zur Kunstreihe „Künstlerinnen präsentieren Künstlerinnen“. Gespannt darf man also auch auf die kommenden Ausstellungen im Heiligengeisthof 3 sein. Wer sich wie ich den Werken Anna Vynogradovas auch einmal schreibend nähern möchte, kann dies am 29. Mai von 10.00 bis 13.00 Uhr im Workshop: „Schreiben zu Kunst“ tun. Die Kuratorin und Autorin Daniela Boltres wird diesen leiten und freut sich schon heute darauf.
23. Mai 2010 | Weiterlesen
Bundesjugendtreffen der Sporttaucher
„Unter Wasser gibt es mal was anderes zu sehen, als hier oben“. So oder so ähnlich äußerten sich viele junge Sporttaucher einhellig am Pfingstwochenende beim Bundesjugendtreffen des Verbandes Deutscher Sporttaucher (VDST) über ihr Hobby. Über 100 Nachwuchstaucher aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich in Warnemünde versammelt, um Gleichgesinnte kennenzulernen und neue Unterwasserreviere zu erkunden. Und was gibt es da nun zu sehen? Maximilian Schladt aus Niedersachsen kommt am Samstagmorgen mit Schnorchel, Maske und Neoprenanzug aus den Fluten der 10°C warmen Ostsee und erzählt: „Die Sicht ist ganz klar. Man kann die Sandbänke gut erkennen. Auf einer habe ich sogar eine Scholle entdeckt. Und zwei kleine Quallen konnte ich auch beobachten.“ Der 14-jährige war mit einer Gruppe von sieben Leuten etwa 90 Meter weit ins Meer gegangen. Dort ist es ungefähr vier bis fünf Meter tief. „Diese Jugendlichen haben schon mindestens zwei Jahre Erfahrung,“ erklärt mir ein Tauchlehrer. „Sicherheit ist sehr wichtig. Tauchen kann gefährlich werden, deshalb müssen gewisse Regeln eingehalten werden. Wir achten darauf, dass die Kids diese auch verstehen.“ Ab acht Jahren werden Kinder an das Tauchen in den Tauchsportvereinen herangeführt. Ihre Fähigkeiten können sie bei verschiedenen Prüfungen unter Beweis stellen und so die Schnorchelabzeichen Otter und Robbe und die Kindertauchsportabzeichen in Bronze, Silber und Gold erwerben. Während wir aufs Wasser schauen und die restliche Tauchgruppe beobachten, ist Nick Schwochow neben uns damit beschäftigt, eine Rettungsboje klarzumachen. „Wurde die heute schon gebraucht?“ frage ich. „Nein, aber falls es nötig sein sollte, ist sie einsatzbereit.“ Eine Gruppe Kinder kommt von einer kleinen Strandexkursion zurück. In einem Eimer haben sie ein paar Fundstücke gesammelt. Peter Helbig aus Hessen greift einen Blasentang heraus und erläutert die Besonderheiten der Unterwasserpflanze. Dann zieht er einen Zigarettenstummel hervor: „Der gehört natürlich nicht ins Meer.“ Den Tauchlehrern und Betreuern ist es ein Anliegen ihren Schützlingen nicht nur die Techniken des Tauchens zu vermitteln, sondern ihnen auch marine Lebensformen und den Naturschutzgedanken näher zu bringen. Es gibt also jede Menge zu entdecken und zu lernen für die 8 bis 20-Jährigen beim Bundesjugendtreffen der Sporttaucher an der Ostsee. Der Spaß darf dabei natürlich auch nicht zu kurz kommen. Mit Beachvolleyball und Staffelspielen sollen die Kids in Bewegung gebracht werden und das ist auch bitter nötig bei den kühlen Temperaturen am Strand. Zum Glück geht es nachmittags in die warme Neptun Schwimmhalle. Hier können sich die jungen Taucher an drei Stationen ausprobieren. Bei der ersten erhalten sie eine Einführung in die Unterwasserfotografie. Mit speziell ausgerüsteten Kameras werden lustige Figuren im Wasser in Szene gesetzt. Besonders gelungene Fotos kommen anschließend in den Fotowettbewerb, der während des Treffens durchgeführt wird. Bei der zweiten Station wird Unterwasserrugby gespielt. Thomas Sträßler aus dem Saarland erklärt kurz die Spielregeln und dann geht es auch schon los. Gemischte Teams mit jeweils sechs Spielern kämpfen um den kleinen, aber schweren mit Salzwasser gefüllten Ball und versuchen ihn in einen der am Beckenboden angebrachten Körbe zu bringen. Während sich beim Unterwasserrugby im Schwimmbecken eine hohe Dynamik entwickelt, geht es im Sprungbecken besonnener zu. Hier können sich die Taucher mit dem Drucklufttauchgerät vertraut machen und ein paar Übungsrunden mit der Ausrüstung schwimmen. Nachdem sich die Tauchgäste die Unterwasserwelten Rostocks angeschaut haben, geht es am nächsten Tag ins Ozeaneum nach Stralsund. Dort erwartet sie ein Einblick in die nördlichen Meere. Hier noch ein paar Impressionen der Nachwuchstaucher von ihren Tauchgängen in der Ostsee (Fotos: VSK Moorteufel):
23. Mai 2010 | Weiterlesen
Eröffnungskonzert: „Wien 1910“ in der HMT
Das klang nicht gerade sehr harmonisch, was ich da am Dienstagabend während des Eröffnungskonzertes des Kammermusikfestivals „Wien 1910“ der Hochschule für Musik und Theater (HMT) im Katharinensaal vernahm. Pauline Reguig spielte Violine und Yasuko Sugimoto Klavier. Doch die Tonabfolgen beider Instrumente schienen mir, kaum aufeinander abgestimmt zu sein. Ein paar Anschläge auf dem Klavier, eben noch leise, dann plötzlich laut. Dazu die Geige, deren Töne ganz für sich allein dahinzuklingen schienen. Qietschig hoch, in schnellem Tempo, dann ein jeher Abbruch. Stille. Plötzlich ging es weiter. Ich hatte keine Melodie erkennen können. Die Musik wühlt innerlich auf, dient aber wohl kaum der Entspannung. Nur, weil ich sie nicht so recht verstehe, heißt das allerdings noch lange nicht, dass es keine großartige Musik ist. Es war nur das erste Mal, dass eine moderne Komposition in meine Ohren drang. Und an das Fehlen jeglicher Melodie müssen diese sich wohl noch ein wenig gewöhnen. Das Stück „Fantasie für Violine und Klavier op. 47“ komponierte Arnold Schönberg 1949. Er war ein Wegbereiter der modernen Musik und seine Kompositionen waren Teil des musikalischen Programms des fünften Kammermusikfestivals der HMT. Erstmals war dieses nicht dem Werk eines einzelnen Künstlers gewidmet. Stattdessen nahm man das musikhistorisch bedeutsame Schwellenjahr 1910 und die Stadt Wien in den Fokus. Worum geht es? Der Dozent, Jan Philipp Sprick und Prof. Dr. Birger Petersen hatten die künstlerische Leitung des Festivals übernommen und gaben, nachdem sie das Publikum herzlich begrüßt hatten, eine kleine Einführung in das Thema. 1910 fand ein musikalischer Epochenwechsel statt. Die romantische Musik wurde von modernen Kompositionen abgelöst und eine neue musikalische Ära begann. Wien war zu jenem Zeitpunkt ein Zentrum der Musikkultur. Der Titel „Wien 1910 – Aufbruch in die Moderne“ verweist also auf eine aufregende Zeit der Veränderungen und des Wandels an einem bedeutenden Ort. Herausragende Komponisten jener Tage waren neben Arnold Schönberg, Gustav Mahler, Alban Berg, Erich Korngold und Hanns Eisler. Sie waren es, die mit ihrer kompositorischen Arbeit die Musik des 20. Jahrhunderts initiierten. Ihre Kompositionen bildeten deshalb auch einen Schwerpunkt des Festivals. Nun aber zurück zum Eröffnungskonzert. Es begann mit Lukas Umlauft. Er trug, noch bevor irgendein Musiker sein Instrument ergriff, den „Prolog zu Lysistrata des Aristophanes“ von Hugo von Hofmannsthal vor. Dieser österreichische Schriftsteller gilt als einer der wichtigsten Repräsentanten der Wiener Moderne, also genau jener Zeit, der das sich Festivalprogramm verpflichtete. Als einsamer Dramaturg stellte sich Lukas Umlauft dem Publikum gegenüber und sprach über Kultur, Gelehrsamkeit, das Theaterschaffen und eine „gigantische Komödie“. Dann wurde ein „Langsamer Satz für Streichquartett“ von Anton Webern vorgetragen. „Hach“, da war sie wieder, die Melodie. Ich konnte mich in das Stück hinein versenken und davon in weite Fernen tragen lassen. Ein einzigartiges Wechselspiel der Gefühle bot sich mir dar. Später erfuhr ich, dass es 1905 entstand. Das bedeutet, es steht noch deutlich in der Tradition der Spätromantik, ist also noch nicht ganz so modern, wie das von Arnold Schönberg eingangs von mir erwähnte Stück. Vor der Pause wurden noch Schönbergs „Drei Stücke für Kammerensemble“ von 1910 vorgetragen. Wieder schienen mir die Instrumente kaum aufeinander bezogen zu sein. Und wieder gab es abrupte Pausen und scheinbar frei assoziierte Tonabfolgen. Schönberg mied ganz bewusst Schematismen und formelhafte Wiederholungen und schuf auf diese Weise Kompositionen, die eine ganz neue, zuvor nie dagewesene und besondere Ausdrucksstärke besitzen. In der Tat bewegten mich die Stücke. War doch kein Ton vorhersehbar. Ein Umstand, der meine innere Anspannung nicht versiegen ließ. Während der Pause gönnte ich mir, wie so einige Konzertbesucher einen leckeren Weißwein und fragte mich: „Gibt es eigentlich Entspannungsübungen für die Ohren? Ohr-Yoga?“. Als dann wieder alle Freunde der modernen Kammermusik ihre Sitzplätze im Katharinensaal gefunden hatten, begann der zweite Teil des Festival-Auftakt-Konzertes. Vorgetragen wurde ein von Franz Schubert komponiertes „Streichquartett d-Moll D 810“, das Gustav Mahler überarbeitet hatte. Auch er stand mit seinem Werk auf der Schwelle zur modernen Musik und seine Kompositionen markieren den Übergang von der Spätromantik zur Moderne. So berief sich neben vielen auch Arnold Schönberg vielfach auf ihn. Das Stück gefiel mehr sehr und ich konnte wohltuend dahin schwelgen. Im Rahmen des diesjährigen Kammermusikfestivals erklangen allerlei Kammermusikkonzerte. Auch ein Lieder- und Klavierabend sowie die Lesung: „Verflossen ist das Gold der Tage …“ mit Texten von Georg Trakl und Hugo von Hofmannsthal wurden geboten. Das vielseitige Programm sorgte ganz sicher nicht nur bei mir für interessante musikalische Erlebnisse und aufschlussreiche Erkenntnisse über den kammermusikalischen „Aufbruch in die Moderne“ im Wien von 1910.
22. Mai 2010 | Weiterlesen
Ausstellung der Dienstagsmaler im Börgerhus
„Bi uns tu Hus“ heißt die neue Ausstellung der Dienstagsmaler, die ab sofort im „Börgerhus“ in Groß Klein zu sehen ist. Dienstagsmaler? „Bi uns tu Hus“? Eins nach dem anderen! Die Dienstagsmaler gibt es seit dem Frühjahr 2006. Schon bald nach der Gründung des Stadtteil- und Begegnungszentrums „Börgerhus“ fanden sie sich dort zusammen, die Hobby- und Freizeitmaler Anita Doß, Gerlinde Bütow, Jochen Krey, Edith Kurtz, Gudrun Herold und Erhard Eycke. Das Malen entspannt und erfüllt sie mit Freude. Sie treffen sich jeden Dienstag, um gemeinsam zu unterschiedlichen Themenkreisen und in ganz verschiedenen Techniken künstlerisch tätig zu werden. Drei Jahre lang leitete Margot Domhardt die Malgruppe. Ab 2009 tut dies Gudrun Herold. Diese meint allerdings, dass eine fachliche Anleitung gar nicht nötig sei. Vielmehr bringe jeder Einzelne sein Wissen immer wieder von Neuem in die Gruppenarbeit mit ein und so würden alle stetig voneinander lernen und Fortschritte machen. Am vergangenen Dienstag, einen anderen Wochentag hätte man wohl kaum wählen können, eröffnete Gudrun Herold die mittlerweile vierte Ausstellung der Gruppe und verriet Näheres über den Titel der Werkschau. Obwohl nur wenige der Hobbymaler Mecklenburger seien, hätten sie die mecklenburgischen Worte „Bi uns tu Hus“ gewählt. Das habe damit zu tun, dass fast alle ausgestellten Werke in der hiesigen Landschaft entstanden seien und Motive dieser Gegend zeigten. Die Malgruppe habe direkt vor Ort gemalt, was sie faszinierte. So entstanden ihre Bilder etwa im Dorf Groß Klein, im Rostocker Stadtgebiet und in ganz Mecklenburg. Dabei hätten sie sich jedoch nicht auf eine bestimmte Technik beschränkt, erklärte die Gruppenleiterin. Die Ausstellung zeige vielmehr Aquarelle, Pastelle, Acryl-Gemälde wie auch Collagen. Mit den ebenfalls mecklenburgischen Worten „denn man tau“ lud sie anschließend alle Interessierten zu einem ersten kleinen Rundgang ein. Edith Kurtz schuf zwei Aquarelle und ein Werk, in dem Aquarellfarben und Zeichentusche zugleich zur Anwendung kamen. Die Aquarelle zeigen die unruhige Ostsee und ein Fischerboot am Strand. Beide seien aber nicht direkt vor dem Motiv entstanden, verriet die Künstlerin. Vor Ort habe sie Fotografien geschaffen, die dann zu Hause als Vorlage dienten. Das Bild, in dem sie Tusche- und Aquarelltechnik verband, zeigt ein goldgelbes Kornfeld. Darüber ziehen dichte Wolken vorüber. In der Ferne am Horizont erstreckt sich eine Reihe von Häusern. Rote Mohnblumen säumen den Feldesrand im Vordergrund. Zeichnerische Elemente ermöglichten eine sehr detailreiche Darstelllung. Die Farbgebung haucht der Landschaft frühlingshaftes Leben ein. So erscheinen die im Wind flackernden roten Fähnchen des Fischerbootes vor dem hellblauen Himmel auf einem der Aquarelle, wie auch schon die Mohnblumen im goldgelben Feld, gleichsam als Boten des Frühlings und der Lebensfreude. Der Frühling inspirierte Anita Doß zu der Darstellung eines Tulpenstraußes. Auch hier goldgelbe und rote Farbtöne. Es ist ein Aquarell, das mit Pastellkreide übermalt wurde. Zwei wunderschöne Tuschezeichnungen der Künstlerin verweisen auf ihr großes zeichnerisches Talent. Die Rinde von Bäumen, ihre knorrigen Äste, Gräser und Sträucher, daneben ein altes Fachwerkhaus, all dies ist bis ins kleinste Detail wiedergegeben. Die Motive insgesamt sprechen von Ruhe und Ausgeglichenheit. Sicher sind es auch Orte der inneren Harmonie. Ein mit Pastellkreide geschaffenes Bild zeigt ein Rotkehlchen. Anita Doß erinnert damit an den letzten langen und kalten Winter in Mecklenburg. Das Vögelchen plustert sich auf. Muss es doch die wenige Körperwärme, die ihm noch geblieben ist, bei sich behalten. Collage-Techniken haben es Gerlinde Bütow angetan. „Muschelträume“ nannte sie ein Werk, das den Himmel mit dem Meer verbindet. Darin verarbeitete sie natürliche Materialien, wie Muscheln, Strandsand und Holz. „Am Barther Bodden“ und „Frühsommer auf Rügen“ sind Werke, die ebenfalls durchs Collagieren entstanden. Die Künstlerin arbeitete hier alte Kalenderbilder in ihre Acrymalereien ein. Der Unterschied zwischen fotografischem Kalenderbild und Malerei ist nur bei näherer Betrachtung erkennbar und fasziniert. Traum und Wirklichkeit, Realität und Fantasie erscheinen vereint. Auch strahlen die Bilder dank leuchtkräftiger Farben. „Frag doch das Meer“, ein Bild, das durch den Kontrast von Blau und Orange besticht. Gerlinde Bütow verarbeitete hier ein altes Volkslied. Zwei Mädchen sitzen am Meer und sehnen sich nach dem Liebsten. Der lange kalte Winter war ihr, wie schon Anita Doß, Anlass ein winterliches Motiv zu malen. Gerlinde Bütow aber stellte Warnemünde in schneeweißer Landschaft dar. Das Meer spielt auch in den von Jochen Krey ausgestellten Werken eine große Rolle. Er malte den Leuchtturm von Hiddensee, eine Steilküste, und ein Fischerboot am Bodden. Den Leuchtturm und die Steilküste führte er in Acrylfarben aus, das Motiv am Bodden in Aquarellfarben. Die Farbgebung wirkt sehr natürlich. Der Künstler malte harmonische Orte voll Ruhe und Ausgeglichenheit. Nichts stört hier die Natur. Im Bild „Am Bodden“ meint man, beinahe das Rauschen des Windes im Schilf vernehmen zu können. Die Hobbykünstlerin Gurdrun Herold zeigt einen „Blick auf das Schweriner Schloss während der BUGA“, „Rostock um 1893“, „Haus: Tausendscheun“ im Dorf Groß Klein, den an der Warnow anliegenden „Notfallschlepper Fairplay 26“ und eine „Reetgedeckte Scheune in Mäkelborg“. Sie verband Tuschezeichnungen mit Aquarellfarben, arbeitete aber auch mit Finelinern und Pastellkreide. Ihre Begeisterung für die Zeichnung und detailgenaue Wiedergabe des Gesehenen ist nicht von der Hand zu weisen. Die Farben leuchten nicht, wirken aber auch hier sehr natürlich. Sehr romantisch und verträumt, ein wenig wie verzaubert, muten die in Pastellkreide ausgeführten Bilder an. Wie etwa das Haus „Tausendscheun“. Es wird von Bäumen und Sträuchern umringt, die im Lichte funkeln. Ganz fein, gleichzeitig zart und weich erscheint das Blattwerk. Die „Reetgedeckte Scheune in Mäkelborg“ wurde zunächst mit einer Rohrfeder gezeichnet und später dann mit Pastellkreide überarbeitet. Einsam steht sie da. Wie im Traume. Die Pastellkreide ermöglichte das Darstellen von Lichtreflexen. Ein Flirren liegt in der Luft. Etwas Märchenhaftes hat auch dieses Motiv an sich. Die Leiterin der Dienstagsmaler stellte zwei Bilder des Hobbymalers Erhard Eycke vor. Er war leider nicht zur Ausstellungseröffnung erschienen. Sie erklärte, Erhard Eycke arbeite sehr gern mit Acrylfarben und habe sich an einem Motiv des Malers Otto Malchin versucht. Es ist in erdigen Farben gehalten. Die „Kleinstadt am Wasser“ malte er in leuchtenderen Farben. Die roten Dächer der Häuser und der Turm einer Backsteinkirche ragen in den tiefblauen Himmel hinein. Es muss ein sehr sommerlicher Tag gewesen sein, der hier dargestellt wurde. Im Vordergrund erscheinen Schilfgräser an einem Gewässer. Nicht nur die Freude am Malen und Zeichnen eint die Dienstagsmaler. Auch ihre Liebe zur Natur verbindet sie. Die Ausstellung „Bi uns tu Hus“ ist ein Zeugnis dieser Naturverbundenheit. Gleichsam wird, wer die Werke betrachtet erkennen, dass ein jeder von ihnen seine ganz eigene Handschrift entwickelt hat. Wer wieder einmal in Groß Klein zu tun hat, die Natur und seine Heimat liebt und obendrein kunstinteressiert ist, sollte dem „Börgerhus“ auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Ach übrigens, es werden noch weitere Hobby- und Freizeitmalerinnen und –maler gesucht. Die Dienstagsmaler treffen sich jeden Dienstag von zehn bis zwölf Uhr im Groß Kleiner Stadtteil- und Begegnungszentrum am Gerüstbauerring 28. Interessierte sind immer herzlich willkommen.
21. Mai 2010 | Weiterlesen
„LEBEN 2.0 - Update Your Life“ im Volkstheater
„Die Zahlen heute: 3, 8, 11, 15, 22, 25“ – stopp! Ein Sechser muss genügen. Wer den 17-Millionen-Jackpot knacken möchte, muss sich die Superzahl schon selbst abholen. Wo und wann? Morgen, am Freitag, im Ateliertheater bei der Premiere von „LEBEN 2.0 – Update Your Life“, einer Stückentwicklung des Theaterjugendklubs. Tja, an dieser Stelle endet dann heute auch schon mein Bericht. Eine Entwicklung weg vom Mann der vielen Worte. Aber hey, ist die Aussicht auf den Jackpot nicht Grund genug, sich das Stück anzusehen? Toll ist das Stück schon, ich habe mir heute die Generalprobe angeschaut. Vielleicht fehlt hier und da ein wenig der rote Faden, aber wirklich nur hier und da und auch nur ein ganz klein wenig. Die Mitglieder des Theaterjugendklubs haben in jedem Fall mit ihrem Spiel überzeugt. Egal ob Christof Lange als HD Klum, Alex Friedland als Leon Omega, Lea-Marie de Boor als Ellen alias Mila oder Lukas Gabriel als Moritz alias Milo. Dem Stück tat es nicht mal einen Abbruch, dass eine der jungen Schauspielerinnen ihre Stimme für die Premiere schonen musste und nur pfeifen durfte. Könnte man als Running Gag fast so beibehalten – kleiner Spaß. Eigentlich könnte ich jetzt doch wieder zum Mann der vielen Worte werden und ganz viel über die Inszenierung schreiben. Zumal es auch tolle Bilder auf der Bühne gab. Bilder, aber leider keine (passenden) Fotos. Okay, dass es dem Schauspielleiter nicht recht sei, dass an diesem Tag Fotos gemacht werden, wusste ich bereits vorher. Etwas unverständlich, aber nun ja. Dass das eigene Team sehr wohl vom Anfang bis zum Ende knipste, ließ mein Verständnis dann allerdings doch etwas schwinden. Welch unbegründete Panik vor ‚externen‘ Bildern am Volkstheater auch immer herrschen mag. Ein Programm oder zumindest eine Liste mit Rollen- und Schauspielernamen gab es leider ebenfalls nicht und da alle Gäste nach der Probe – schneller als ich denken konnte – hinausgebeten wurden, blieb auch keine Chance zur Nachfrage. Nun könnte ich natürlich alle Darsteller als Jane oder John Doe bezeichnen – bei der Fülle an Mitwirkenden dürfte dies aber etwas verwirren, zumal es John Doe Fox auch noch als Rolle gab. Tolles Stück, tolle Schauspieler, schlechte Öffentlichkeitsarbeit (Janny Fuchs sei an dieser Stelle ausdrücklich ausgenommen). Keine Infos, kein Bericht. Wen das interessiert? Wohl niemanden, die Besuchszahlen entwickeln sich ja ach so erfreulich. Zudem ist es doch eh nur das Internet, ach was sag ich, eine einzelne Internet-Site. Womöglich gar noch mit jungem Publikum. Und das bei einer Aufführung von ebenso jungen Schauspielern und ganz zufällig auch noch zum Thema Internet und Web 2.0 – passt doch eh nicht. Womöglich könnte sich gar noch ein neuer Besucher ins Theater verirren – Schock! Wer trotzdem wissen möchte, wie die jungen Schauspieler des Theaterjugendklubs ihre Sicht auf das Leben in Zeiten von Google, FaceFoxbook und Co. auf die Bühne bringen, was es mit Omega auf sich hat und wie ein Knopfdruck und eine Frequenz unser aller Leben auslöschen können – morgen um 19:30 Uhr ist Premiere. Und sei es nur, um die Superzahl für den Jackpot abzugreifen – der Kreis schließt sich. Ach ja, der Vollständigkeit halber: Das zur Verfügung gestellte Foto stammt von Christine Ruynat, danke.
20. Mai 2010 | Weiterlesen
Universum Champions Night - Boxen in Rostock
Am Samstag fliegen in der StadtHalle Rostock wieder einmal die Fäuste. Im Rahmen der „Universum Champions Night“ stehen drei Kämpfe im Schwergewicht auf dem Programm. Gestern zeigten sich die Boxer aber erst mal ihren Fans – beim öffentlichen Training im Ostseepark Sievershagen. Neben den Schwergewichten steht Vitali Tajbert (27), Weltmeister des World Boxing Council (WBC) im Superfedergewicht, in Rostock seine erste Titelverteidigung bevor. Im November 2009 hat er in Kiel den Mexikaner Humberto Mauro Gutierrez besiegt. Nun trifft Vitali wieder auf einen Gegner aus Mexiko, auf den überaus erfahrenen Hector Velazquez (35). Für Box-Fans dürfte es ein Leckerbissen werden. „Ein K.o. kann ja jeder“, so Vitali Tajbert, „ich will 12 Runden die Fans begeistern.“ Im Hauptkampf trifft Schwergewichtler Ruslan Chagaev (31) auf den Australier Kalivath Gerald Meehan (40). Mit einer Größe von 1,86 m ist Chagaev zehn Zentimeter kleiner als der Hüne Meehan und liegt mit Platz 3 der WBA-Rangliste direkt hinter seinem Gegner. Für Chagaev, Kampfname „White Tyson“, dürfte es am Samstag in Rostock um alles oder nichts gehen. Im Juni verlor der Usbeke in Schalke seinen WBA-Titel gegen seinen ehemaligen Stallkollegen Wladimir Klitschko. Nach 11 Monaten Pause steigt er hoch motiviert wieder in den Ring, zum offiziellen WM-Ausscheidungskampf der WBA. Das Ziel ist klar: Die WM-Krone der WBA soll zurückerobert werden. Mit allen Wassern gewaschen sein dürfte aber auch sein Gegner Meehan, Kampfname „Checkmate“. Wird er doch von Box-Promoter-Legende Don King betreut. In seiner ihm typischen Art meldete sich King schon im Vorfeld zu Wort: „Meehan wird Chagaev ausknocken. Es wird eine Zerstörung.“ – Samstag werden die Fäuste sprechen. Don King hatte heute seinen Auftritt im Rostocker Rathaus. Mit den Worten „Ich bin ein Rostocker!“ trug sich eine der umstrittensten Figuren des Boxsports auf Einladung von OB Roland Methling ins Gästebuch der Hansestadt ein. Ob Roland Methling mit dem überdimensionierten Boxhandschuh am Samstag selbst in den Ring steigen oder einfach nur mal kräftig auf den Tisch hauen möchte – abwarten! Am meisten Spaß dürften gestern Nachmittag aber ganz sicher die Jungs und Mädels des Kinderhilfsprojektes Frogs for Future gehabt haben. Der Verein unterstützt Kinder aus sozial benachteiligten Familien und ermöglicht ihnen mit Paten und Sponsoren die Mitgliedschaft in Sportvereinen. Wann bietet sich für die Kids schon mal die Möglichkeit, mit ihren Idolen Chagaev und Tajbert gemeinsam im Ring zu stehen? Vitali Tajbert zeigte sich gut gelaunt und lud die begeisterten Kids spontan zur Champions Night ein. Was man braucht, um ganz nach oben zu kommen? „Vor allem Disziplin und Respekt“, gab der Weltmeister im Superfedergewicht dem neugierigen Nachwuchs mit auf den Weg. „Respekt vor dem Trainer, dem Gegner und den Mitmenschen.“ Anschließend verteilte Vitali Tajbert noch Minihandschuhe an die kleinen „Weltmeister von Morgen“. Bei einem kleinen Geschicklichkeitsspiel gab es als Abschluss für die Zuschauer noch etwas zu gewinnen – Freikarten für die Boxveranstaltung am Samstag. Alice Berger bewies beim Fangen des fallen gelassenen Balls eine gute Reaktionsfähigkeit und durfte sich mit Söhnchen Leonardo (3) über zwei Eintrittskarten fürs Wochenende freuen. Der Dreijährige dürfte aber wohl daheimbleiben.
20. Mai 2010 | Weiterlesen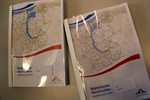
Statistische Nachrichten: Stadtbereiche 2009
„Stadtbereiche 2009“ – so der Titel der Publikation, die unsere Hansestadt in Zahlen vorstellt. „Die Struktur und Entwicklung der einzelnen Stadtbereiche der Hansestadt Rostock ist sehr unterschiedlich“, erklärte Georg Scholze, Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung. „Genaue Informationen dazu werden in der neuen Broschüre der Statistikstelle veranschaulicht.“ Das ausgesprochen umfangreiche Werk vermittelt eine Vielzahl an Daten zur Bevölkerungs- und Sozialstruktur, zur Wirtschaft und zum Arbeitsmarkt, zur Bautätigkeit sowie zum Wohnungsbestand, zum Kraftfahrzeugbestand, zur Kriminalstatistik wie auch zum Wahlverhalten. Der Bestand an infrastrukturellen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Kinderspielplätzen, Schulen, niedergelassenen Ärzten, Apotheken sowie Alten- und Pflegeheimen wird ebenfalls veranschaulicht. Auf über 400 Seiten werden straßengenaue Bevölkerungszahlen nebst detaillierten Untersuchungen zu allen Stadtbereichen präsentiert. Die Datensätze der 21 Stadtbereiche wurden mit den Daten der Stadt insgesamt und untereinander verglichen. Anhand dieser vielfältigen Angaben können strukturelle Problemstellungen analysiert und beurteilt werden. Veranschaulichend wirken viele farbige Grafiken und thematische Karten. Sehr interessant waren die großen Unterschiede, die beim Vergleich der einzelnen Stadtbereiche sichtbar wurden. Während die Kröpeliner-Tor-Vorstadt mit 18.873 Einwohnerinnen und Einwohnern der einwohnerstärkste Stadtteil ist, leben in Dierkow-Ost nur 1.126 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Kröpeliner-Tor-Vorstadt sind durchschnittlich 36 Jahre jung. Das Durchschnittsalter der Warnemünder dagegen beträgt 53 Jahre. In Groß-Klein, Schmarl und Dierkow-Neu wurden die höchsten Arbeitslosenquoten von 16 Prozent festgestellt. Auch wurde ermittelt, dass sich 11 von den insgesamt 50 Apotheken der Hansestadt Rostock in der Stadtmitte befinden. In 7 Stadtbereichen gibt es dagegen gar keine Apotheke. Doch die Stadtbereichsinformation gibt darüber hinaus auch Auskunft über die Entstehung der Stadtbereiche und Gewerbeansiedlungen, die Entwicklung der Bausubstanz sowie das Auftreten von Straftaten. Carmen Becke von der kommunalen Statistikstelle im Hauptverwaltungsamt der Hansestadt Rostock verwies noch darauf, dass die statistische Broschüre auch als Pdf-Datei auf einer Daten-CD erhältlich sei. Mit dieser ließe sich vielfach besser arbeiten, meinte sie und erklärte auch, woher all die Informationen überhaupt bezogen werden: Datenquellen für die Publikation seien vor allem die amtliche Statistik in Schwerin und die Register der Stadtverwaltung. Die Publikation „Statistische Nachrichten: Stadtbereiche 2009“ steht ab sofort allen Interessierten zur Verfügung und kann beim Hauptverwaltungsamt in der Kommunalen Statistikstelle erworben werden.
19. Mai 2010 | Weiterlesen
Björn Kern: „Das erotische Talent meines Vaters“
„Von Nienhagen bis Warnemünde habe ich schon einen Strandspaziergang hinter mir“, verriet uns der Schriftsteller Björn Kern gestern zu Beginn seiner Lesung. Da derartige Wanderungen nicht nur hungrig, sondern auch müde machen, „müssen wir als Publikum aufpassen, dass uns der Autor nicht einschläft“, scherzte Katinka Friese vom Literaturhaus. Ans Einschlafen war an diesem kurzweiligen Abend natürlich nicht zu denken – weder beim Publikum, noch beim Autor. Ein wenig locken musste sie den Schriftsteller aber schon, so Katinka Friese. Nicht nur mit der Aussicht auf den erholsam-anstrengenden Strandspaziergang, sondern auch mit einer Lesung bei Bier und Lagerfeuer. Von den winterlichen Temperaturen Mitte Mai konnte ja niemand etwas ahnen. Vorstellen wollte Björn Kern an diesem Abend seinen neuen Roman „Das erotische Talent meines Vaters“. Bevor es soweit war, las der Autor aber erst einmal das Eingangskapitel seines Debütromans „KIPPpunkt“. Der Kipp- oder Wendepunkt, den Karsten, der jugendliche Held seines Erstlingswerks, erlebt, als er seine Freundin und damit den Bezug zur Realität verliert und nach einem Amoklauf in der JVA landet. „Obwohl oder auch gerade weil das so gar nichts mit meinem aktuellen Buch zu tun hat, lese ich daraus ganz gerne vor“, so Kern. Sei es doch der Text, der ihn überhaupt zum Schreiben gebracht hat. Vom jugendlichen Zivi und Amokläufer Karsten nun aber zu Jakob, seinem Vater mit dem erotischen Talent. Auf der einen Seite Jakob, 68er-Generation, freizügig, gerade seinen zweiten Frühling erlebend: „Ich werde verfolgt! Von der Damenwelt.“ Nach vier kämpferischen Jahrzehnten erlaube sich der Vater nun, „das Wir durch das Ich zu ersetzen, bevor es das Ich nicht mehr gäbe.“ Dem gegenüber steht sein bürgerlicher Sohn. Ein klassischer Vater-Sohn-Konflikt, nur mit umgekehrten Voraussetzungen. „Eigentlich versuchen Vater und Sohn nur, auf knapp 200 Seiten ins Gespräch zu kommen“, fasst es Björn Kern etwas salopp zusammen, „was jedoch grandios scheitert. Am Ende gibt der Sohn auf.“ Die Details sollen an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten werden. Fragestunde. Was den aktuellen Roman von seinen bisherigen Werken unterscheide? „Atmosphäre mal drei Seiten Atmosphäre sein zu lassen“, sei etwas, das es in seinen bisherigen Romanen nicht gab. Aber eine Stimmung, wie an jenem Frühsommernachmittag am Bodensee einmal ganz ausführlich und bildhaft zu beschreiben, „war mir hier ganz wichtig“. Ein Jahr hat Björn Kern schließlich in Konstanz gelebt und nach dem ersten Provinzschock für den Berliner wollte er dort gar nicht mehr weg. Zwar abgedroschen und meist völlig ohne Realitätsbezug, aber doch die Frage der Fragen: Wie viel Autobiografisches steckt in dem Buch? Heute mal etwas abgewandelt: Hat der Vater das Buch gelesen und hat er sich zumindest teilweise darin wiederentdeckt? Figuren, die sich Vater nennen, deshalb aber noch lange nicht sein Vater sind, gab es auch schon zuvor. Die Frage der Enterbungsandrohung hätten sie somit bereits hinter sich, so Kern. „Und ja, er hat es gelesen, es hat ihm sehr gut gefallen, er hat vor sich hin geschmunzelt, aber wiedererkannt hat er sich nicht.“ Bliebe noch die Frage nach dem gewünschten Ableben. Auf was für Fragen man beim Lesen des Buches doch so kommen kann. „Ich würde gern einfach verschwinden, einfach so weg sein.“ Ohne große Hinterlassenschaften, ohne Grab, ohne Urne. Na ja, wäre das auch geklärt. „Wir versuchen das so einzurichten“, verspricht Katinka Friese. „Ein möglichst seichter Unterhaltungsroman“ schwebte Björn Kern beim Schreiben vor, „einfach, um mich selbst ein wenig zu schonen und weil ich keine Lust mehr auf die harten Themen hatte. Ich war dann doch überrascht, was die Leute jetzt alle anfangen da rein zu lesen.“ Von der Abrechnung mit den 68ern, über eine Psychogramm-Studie zwischen Vater und Sohn bis zur Abrechnung mit der Provinz. „Die ganzen Rückmeldungen, an die man überhaupt nicht gedacht hat“ fände er schon unterhaltsam, so Kern. „Wenn man das Buch einfach nur im Sommer auf dem Balkon liest, freut mich das aber genauso.“ Knapp 200 Seiten hat der Roman. Zum Glück nicht mehr, möchte ich sagen, denn hat man ihn einmal in der Hand, mag man ihn vor dem Ende kaum wieder weglegen. Trotz der oft langen Sätze (wohl eine heimliche Leidenschaft des Autors), fesselt das Buch. Was dem Vater sein erotisches Talent, ist dem Autor sein schriftstellerisches – somit genau die richtige Kost für einen dieser langen, unfreundlichen Mai-Abende. Das versprochene Bier und Lagerfeuer gab es zum Abschluss auch noch und so klang ein netter Abend im Garten des Peter-Weiss-Hauses aus. Ganz klar das Literaturhaus mit dem größten Charme, so der Autor. Vorausgesetzt, der Wind treibt den Rauch des Feuers nicht immer in seine Richtung. 10.000 gesunde Schritte auf der Flucht ums Lagerfeuer? Und das nach dem Strandspaziergang! Das Rostocker dürfte dennoch geschmeckt haben. Unter den Gästen fand sich übrigens auch der Rostocker Autor Volker H. Altwasser („Letzte Haut. Historischer Roman.“), der am Freitag eigentlich seinen neuen Roman „Altwassers letztes Schweigen. Ein Abwrackroman“ im Theater im Stadthafen vorstellen wollte. Da dieser erst am 28. Juni erscheint, verschiebt sich auch die Lesung auf Ende Juni – den Termin einfach schon mal vormerken! Zwei weitere Einträge für den Terminkalender gibt es gleich noch hinterher: Am 28. Mai ist der Berliner Schriftsteller Thomas Kapielski zu Gast, der den diesjährigen Preis der Literaturhäuser erhält. Am 2. Juni kommt dann Harry Rowohlt ins Literaturhaus Rostock – ich sag nur: „Pu der Bär“ und „Pooh’s Corner". Und wer so gar nicht liest, dürfte ihn vielleicht immerhin als Harry aus der Lindenstraße kennen.
19. Mai 2010 | Weiterlesen
Nikolai Pagodins „Aristokraten“ in der HMT
Bald schon wird es wohl keinen Raum in der Hochschule für Musik und Theater (HMT) mehr geben, in dem ich noch nicht war. Gestern ging es in das Studio 1. Dort wurde das Stück „Aristokraten“ von Nikolai Pagodin präsentiert. Und so begann es: Kein Licht erhellte den Raum. Ich sah nichts. Doch in der Dunkelheit erklangen die leisen Töne einer Mundharmonika. Dann wurde es plötzlich heller und drei Gestalten erschienen. Auf einem Bett im Hintergrund saß die Dame Njurka. Sie trug eine Art Monokel im rechten Auge und zeichnete in einem Buch herum. Auf einer Pritsche im Vordergrund lag die merkwürdig abwesend wirkende Kulakenfrau mit Kopftuch. Sie spielte Mundharmonika. Am Fenster stand Ninka. Sie schien die beiden anderen und den Raum, in dem sie sich befanden, noch nicht sehr lange zu kennen. „Guckt euch bloß den Himmel an“, sprach sie. Die Njurka sah kurz auf und antwortet irgendetwas auf Russisch. Ninka: „Wie heißt das hier eigentlich?“. Njurka antwortete: „Karelien, dreckige Gegend“. Plötzlich meldete sich die Kulakenfrau zu Wort: „Erst schuften, dann verrecken“. Ninka: „Schuften?“. „Am Kanal, drüben“, erwiderte Njurka. Die Kulakenfrau daraufhin sehr nachdrücklich: „Aber ohne uns!“ Die Szene spiele in der Frauenbaracke eines sibirischen Arbeitslagers, erklärte Prof. Harry Erlich vor Beginn der Darbietung. Er hatte die von den Studierenden im 6. Semester erarbeitete Fassung zusammengestellt. Das Stück wurde also nicht originalgetreu wiedergegeben. Vielmehr montierte man Szenenfetzen, Texte und Figurenentwürfe zu einer Szene „von der wir glauben, dass sie Interesse erwecken kann und hoffentlich auch wird“, so Prof. Erlich. Die Studierenden sind zukünftige Spielleiter. Später werden sie Schauspiele am Theater leiten. Damit sie aber auch einmal als Schauspieler erfahren, was es heißt, eine Gruppenszene zu inszenieren, wirkten sie an dieser Projektarbeit mit. Nikolai Pagodin schrieb das Stück „Aristokraten“ 1932. Es wird zur russischen Revolutionsdramatik gezählt. Prof. Marion Küster, die das Projekt ebenfalls anleitete, gab eine kleine Einführung in die Thematik der Aufführung. 1931 hätten in Karelien die Bauarbeiten für den Weißmeer-Ostsee-Kanal begonnen, sagte sie. Diesen Kanal, der St. Peterburg mit der Barentssee verbinde, hätten unzählige Häftlinge mit erbaut. Stalin habe ihn initiiert, um außenpolitisch die Stärke des Sozialismus zu demonstrieren. Die Häftlinge arbeiteten unter katastrophalen Bedingungen und hunderttausende starben dabei. Nikolai Pagodin war allerdings sehr pro-russisch eingestellt und so handelt sein Stück weniger von dieser negativen Seite des gigantischen Bauprojektes. Zurück zur gestrigen Aufführung. Die Kulakenfrau war politischer Häftling. Ninka und die Njurka dagegen Kleinkriminelle. Die Njurka etwa hatte hauptberuflich Papiere gefälscht. Stolz zeigte sie der Landstreicherin Ninka den selbst gezeichneten Miliz-Stempel. Da brauste auch schon die Taschendiebin „Zitrone“ auf und legte sich sogleich mit Ninka an. Alle im Raum verstummten aber, als Sonja den Raum betrat. Sie wirkte überaus brutal und gefühlskalt. So wollte sie etwa mit der Kulakenfrau ein Kartenspiel um die kleine Ninka in Gange bringen. Doch diese zog es vor, um die Ehre zu spielen. Das genügte Sonja nicht. Die Karten waren längst schon versteckt, als unversehens der Kalfaktor, ein Gefangener, der im Dienste der Vollzugsbeamten im Lager arbeitete, die Baracke betrat. In diesem Moment hielten plötzlich alle Frauen zusammen und schwuren, keine Spielkarten bei sich zu tragen. Er war sich jedoch sicher, welche gesehen zu haben. Grund seines Erscheinens war aber eigentlich eine Liste für den Arbeitseinsatz am nächsten Tag. Er versuchte, die Frauen zur Mitarbeit zu überreden. „Vom Arbeiten sind schon Pferde verreckt“, antwortete Ninka ihm. Auch mit dem Argument der Haftzeitverkürzung durch Arbeit konnte der Kalfaktor keine der Frauen überzeugen. Am Ende fragte Sonja alle Frauen: „Will hier jemand den Sozialismus aufbauen?“ Nachdem sich niemand meldete, zerriss sie die Liste. Es spielten Julia Giering als „Sonja“, Meike Faust als „Zitrone“, Anja Willutzki als „Ninka“, Julia Klein als Dame „Njurka“, Carola Romanus als „Kulakenfrau“ und Benjamin Salopiata als „Kalfaktor“. In dem kleinen Raum hatte ich den zukünftigen Spielleitern ganz aus der Nähe zuschauen können. Ihre schauspielerische Leistung faszinierte mich sehr. Die unterschiedlichen Charaktere wurden derart glaubwürdig vorgeführt, dass ich wohl nichts Falsches behaupte, wenn ich sage, wer selbst so spielen kann, wird später grandios inszenieren und Schauspieler anleiten können.
18. Mai 2010 | Weiterlesen
Hansa Rostock verliert Relegation und steigt ab
Alles oder nichts. Um nicht weniger ging es heute Abend für die Fußballer des FC Hansa Rostock im Relegationsspiel gegen den FC Ingolstadt 04. Die Bayern konnten das Hinspiel, zu dem die Rostocker Fans nach den Ausschreitungen in Düsseldorf ausgeschlossen waren, knapp mit 1:0 gewinnen. Hansa stand damit von Anfang an unter Zugzwang. Doch mit der Unterstützung der Zuschauer – 22.000 an der Zahl – wollten sie alles tun, um das Ergebnis umzubiegen und die verkorkste Saison doch noch zu retten. „Ich gehe seit 35 Jahren hier her, aber noch nie so ungern wie heute“, äußerte sich Vereinsmitglied Klaus Fischer vor dem Spiel. Er dürfte nicht der einzige Fan gewesen sein, der sich an diesem Abend mit einem mulmigen Gefühl ins Stadion begeben hat. Ein anderer Fan, Mario Dibowski, meinte im Vorfeld: „Alles wird gut, wir müssen das Beste hoffen.“ Zweckoptimismus war angesagt. Aber es wurde nicht gut. Bereits nach acht Minuten brachte Fabian Gerber die Ingolstädter mit 1:0 in Führung. Damit musste Hansa mindestens drei Tore schießen, um den Verbleib in der 2. Bundesliga zu erreichen. Zum Entsetzen der Fans konnte die Mannschaft das Spiel aber nicht mehr drehen, im Gegenteil, es sollte noch schlimmer kommen. Erneut war es Fabian Gerber, der den Ball in der 78. Minute zum 2:0-Endstand im Rostocker Tor versenkte. Das erhoffte Wunder in der Hansestadt blieb aus. Damit ist der erste Abstieg des FC Hansa Rostock in die Drittklassigkeit besiegelt. Der Verein steht nach einer katastrophalen Saison vor einem Scherbenhaufen und es wird einen großen Umbruch geben. Gerade einmal acht der Spieler im Kader verfügen über Verträge, die auch für die dritte Liga Gültigkeit besitzen, die Zukunft der übrigen Spieler ist ungewiss. Und auch im Aufsichtsrat wird es mit Sicherheit zu personellen Veränderungen kommen. Die Fans übten sich in der Schlussphase der Partie in Galgenhumor und skandierten: „Außer Walke könnt Ihr alle gehen“ oder „Walke in den Sturm“. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Mannschaft bereits aufgegeben, wie es schien. Dass Torwart Alexander Walke dem FC Hansa in der 3. Bundesliga erhalten bleibt, darf derweil bezweifelt werden – gerüchteweise begleitet er Fin Bartels zum FC St. Pauli. „Das war eigentlich schon die ganze Saison, die verpatzt war“, brachte Maik Schröder die Situation nach dem Spiel auf den Punkt, versuchte aber dennoch bei aller Enttäuschung noch positiv in die Zukunft zu blicken: „Vielleicht ist die dritte Liga ja ein neuer Start für etwas Gutes.“ Ein anderer Fan meinte nur resigniert „das dauert noch Monate, bis ich das verdaut habe“. Der Schock sitzt jedenfalls tief. Bleibt nur die Hoffnung auf einen schnellen Wiederaufstieg am Ende der nächsten Saison.
17. Mai 2010 | Weiterlesen
10. Rostocker Klaviernacht in der HMT
Chopin? Liszt? Haydn? Berühmte Komponisten waren das. Ja. Aber viel mehr wusste ich bisher, man möge es mir verzeihen, leider nicht. Klaviermusik, die mag ich. Aber ein klassisches Stück habe ich mir, heute tut es mir unsagbar leid, kaum einmal angehört. Gestern konnte ich in der Rostocker Hochschule für Musik und Theater all diese Defizite ins Gegenteil verkehren und den wundervollen musikalischen Darbietungen junger Klaviervirtuosen lauschen. Zur selben Zeit, als Werder Bremen in Berlin gegen Bayern München um den Pokal spielte und wahrscheinlich halb Deutschland daheim vor dem Fernseher saß, fand im Katharinensaal die bereits 10. Klaviernacht statt. Als ich die Kreuzgänge des altehrwürdigen Gebäudes betrat, herrschte dort schon reges Treiben. „Der Saal wird wohl voll werden“, dachte ich. Erwartungsvoll setzte ich mich in eine der vielen Sitzreihen und freute mich auf das mir in den nächsten Stunden zuteilwerdende Klangerlebnis. Was es mit dem kleinen Zettel, den ich beim Eintritt in die Hand gedrückt bekommen hatte und den vielen Namen, die darauf standen, auf sich habe, erklärte Prof. Matthias Kirschnereit. Zunächst aber begrüßte er alle Anwesenden herzlich. Dann erfuhr ich, das Papierchen mit den vielen darauf gedruckten Namen sei ein Stimmzettel. Die Klaviernacht werde nämlich durch einen kleinen Wettbewerb begleitet. Die vielen Namen gehören den Pianistinnen und Pianisten. Und mir, wie dem gesamten Publikum, wurde nun die schwierige Aufgabe zuteil, Kreuzchen auf dem Zettel zu vergeben – für sechs der insgesamt 18 Studierenden, deren Pianospiel ich am schönsten empfand. Am Ende des Abends sollten dann nach Auszählung der Stimmen in der Cafeteria des Hauses sechs sogenannte Publikumspreise von je 50 € übergeben werden. In diesem Jahr stiftete diese freundlicherweise das Pianohaus Möller. „Oh je“, ich wusste gleich, dass mir das nicht leicht fallen würde. Die gerade einmal 10 Jahre junge Ngyuen Hai Thao My eröffnete den Konzertmarathon mit dem „Walzer e-Moll op. posth.“ von Frédéric Chopin. Wie flink die kleinen Hände und Fingerchen über die Tastatur glitten. Solch famose Darbietung hab ich nie zuvor erleben können. Unglaublich, welch großes Talent schon in so kleinen Kinderseelen steckt. Ich war hellauf begeistert. Das war ein grandioser Auftakt. Ngyuen Hai Thao My ist, wie auch Charlotte Kuffer und Rebecca Krause, die nach ihr spielten, Schülerin der “young academy rostock”. Dieses „Internationale Zentrum für musikalisch Hochbegabte“ sieht sich der Frühförderung spitzenbegabter junger Musiker verpflichtet. Was dann kam, erfüllte mich durchweg mit Begeisterung. Ich hörte Stücke von George Gershwin, Sergei Wassiljewitsch Rachmaninoff, Edvard Grieg und Franz Liszt. Eike Andreas Letzgus spielte das Stück „Suggestion diabolique op. 4/4” von Sergei Sergejewitsch Prokofjew. Das gefiel mir sehr, konnte ich doch genau hören, wie diese „diabolischen Einflüsterungen“ zunächst zaghaft herantapsten und dann die Überhand gewannen. Während der ersten der zwei Pausen konnte das bereits erwähnte unheimlich wichtige Fußballspiel im Foyer mit verfolgt werden. Daneben war für Speis und Trank gesorgt und viele Konzertbesucher nutzten die Pause für ein kleines unterhaltendes Zusammentreffen. Sicher wurden hier auch schon die ersten Prognosen für die Publikumspreise abgegeben. Johann Sebastian Bach, Alexander Skrjabin, Claude Debussy – bald schon, das wusste ich, würde mir in Sachen Klaviermusik niemand mehr einen Schubert für einen Liszt verkaufen. Vollkommen fasziniert hörte ich auch den von Sarah und Susan Wang vorgetragenen Stücken aus der „Rhapsodie Espagnole“ von Maurice Ravel zu. Gegen 23:30 Uhr endete das fulminante Klavierkonzert und ich begab mich in die Cafeteria, wo der Publikumspreis bekannt gegeben werden sollte. Die Auszählung der Stimmen dauerte noch eine kleine Weile und so ward mir die Zeit gegeben, noch gemütlich einen Kaffee zu trinken. Etwas ermüdend hatten die 35 vorgetragenen Stücke trotz oder gerade dank ihrer Großartigkeit auf mich gewirkt. Neben Eike Andreas Letzgus erhielten Nikolai Gerassimez, Andreas Hering, Stefan Veskovic, Jinho Moon und Vasyl Kotys den begehrten Publikumspreis. Prof. Matthias Kirschnereit übergab ihnen die Urkunden und bedankte sich noch einmal bei allen Mitwirkenden. Ich beschloss am Ende der Klaviernacht, mir bald schon meine erste Klaviermusik-CD zu kaufen und fuhr, froh über die fulminante Erweiterung meines kleinen musikalischen Kosmos, nach Hause.
16. Mai 2010 | Weiterlesen
18. Rostocker E.ON edis Citylauf
„Es gibt kein schlechtes Laufwetter” kommentierte Moderator Matthias Bohm heute Morgen den 18. Rostocker E.ON edis Citylauf. Vom regnerischen und kühlen Wetter ließen sich die Läufer und Läuferinnen jedenfalls nicht abschrecken. Auch nicht vom Gegenwind und so erlebte der Citylauf in diesem Jahr wieder eine rege Beteiligung. Im Laufe des Tages wurde dann auch das Wetter besser. In sechs Disziplinen begaben sich mehr als 2.000 Sportler auf den 3 km langen Rundkurs durch die Rostocker Innenstadt. Zum zweiten Mal wurde, nach dem großen Erfolg im Vorjahr, auch wieder der Staffellauf über fünf mal drei Kilometer ausgetragen. Die Starts erfolgten – je nach Disziplin – am Neuen Markt, dem Universitätsplatz oder am Kröpeliner Tor. Für Stimmung an der Zielgeraden am Neuen Markt sorgten Sascha Paul, Erik Hansen und Felix Behnert vom Projekt „Beach Drumming“ des Musikvereins Amber-City e.V. Sie spornten die Zuschauer mit improvisierten Rhythmen zum Anfeuern der Sportler an. Den Anfang machten um kurz vor zehn Uhr morgens die Handbiker, dicht gefolgt von den Staffelläufern und den Läufern des Halbmarathons. Die 20,23 km lange Strecke konnte Oliver Polling bei den Handbikern am schnellsten zurücklegen. Er benötigte dafür gerade einmal 43 Minuten und 36 Sekunden. Auf Platz zwei und drei folgten Björn Kanter und Jan Beckmann. Den Halbmarathon über 21,1 km konnte bei den Damen die Vorjahreszweite Claudia Fiddecke für sich entscheiden. Sie setzte sich mit einer Zeit von 1 Stunde, 33 Minuten und 5 Sekunden vor der Konkurrenz durch. Bei den Herren dagegen siegte Jasper Menze in einer sensationellen Zeit von 1:11:32. Der Chemiestudent ist vor gerade einmal drei Monaten aus dem Ruhrgebiet nach Rostock gezogen und konnte sich bei seiner Premiere beim Citylauf gleich den Sieg sichern. Dabei verbesserte er sogar seine persönliche Bestzeit um ganze drei Minuten und das obwohl er nach eigener Aussage kaum trainiere. Im nächsten Jahr möchte er auf jeden Fall wieder mit dabei sein um seinen Titel zu verteidigen. „Die Strecke ist zu kurz, die sehen alle noch viel zu gut aus“, kommentierte Moderator Matthias Bohm den Zieleinlauf der Staffelläufer. Bereits im Vorjahr gehörte der Staffellauf zu den Highlights der Veranstaltung und auch in diesem Jahr sollte sich daran nichts ändern. Ganze 50 Staffeln gingen am Morgen an den Start, einige davon in extravaganten Kostümen, die am Ende prämiert wurden. Der Sieg in dieser Disziplin ging an die Staffel des 1. LAV Rostock, die als einziges Team die Strecke in weniger als einer Stunde zurücklegen konnte. Auf den Plätzen folgten die Teams „Verlaufen“ und die Staffel des LT Sportstudios. Einen Sonderapplaus hatten sich die Youngsters „die schnellen Wadenbeißer“ verdient. Simon (7), Johannes (10), Jakob (9), Fiete (10) und Josi (5) konnten die Strecke als jüngstes Team in 1:20:14 bewältigen. Trotz Zaubertrank reichte es für das Team Sprintefix.de nicht zum ersten Platz. Dafür konnten Fritz Lange als Lügfix, Karl Lange als Obelix, Jana Kiesendahl als Falbala, Roland Kiesendahl als Asterix und Felix Schröder als Miraculix aber den Preis für den besten Staffelstab entgegennehmen. Sie trugen einen Hinkelstein durch die Rostocker Innenstadt. Damit wiederholten die fünf Läufer ihren Erfolg des Vorjahres. Da hatten sie bereits – als Urmenschen verkleidet – die Zuschauer begeistern können. Als Belohnung für ihre Kreativität dürfen die Wahlgallier den FC Hansa Rostock am Montag gegen den FC Ingolstadt im Stadion unterstützen. Am Mittag waren dann die Läufe über drei, sechs und zehn Kilometer angesagt. Allein für den 3 km langen Schnupperlauf gab es im Vorfeld über 600 Anmeldungen. Jung und alt begaben sich auf die 3 km lange Runde – ein regelrecht generationenübergreifendes Ereignis. Bereits zum 8. Mal mit dabei war in diesem Jahr auch wieder die Rockband „City“, die für einen guten Zweck an den Start ging. Die Musiker sammelten während des 3 km Laufes Geld für den Fischkutter e.V., einen Verein, der sich um benachteiligte Jugendliche kümmert. Von dem gesammelten Geld möchte die Band dem Verein ein Keyboard schenken. Den Sieg sicherte sich Lukas Reichswald in der Herrenwertung. Die schnellste Frau im Feld war Leonie Poppe. Auf der 6 km Strecke konnten sich Katharina Splinter und Reno Kolrep durchsetzen. Den finalen Lauf über 10 km gewannen Dennis Mehlfeld und die Triathletin Christiane Pilz. In allen Disziplinen erreichten insgesamt 2.128 Läufer das Ziel. Die zahlreichen Zuschauer und Sportler konnten sich außerdem an verschiedenen Ständen stärken, mit Getränken versorgen und gemeinsam feiern. Der 18. Citylauf war damit wieder ein voller Erfolg. Dieses Jahr nicht mitgelaufen? Dann haltet Euch den 22. Mai 2011 am besten schon einmal frei, denn da startet der 19. Rostocker Citylauf.
16. Mai 2010 | Weiterlesen
Marc Lindemann: „Unter Beschuss“
Am Mittwochabend war der Politologe Marc Lindemann in der Buchhandlung Weiland zu Gast, um sein Buch: „Unter Beschuss. Warum Deutschland in Afghanistan scheitert“ in Rostock vorzustellen. Als Nachrichtenoffizier ist er 2005 sowie in den Jahren 2008 und 2009 für die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz gewesen. Dort hatte er sicherheitsrelevante Informationen beschafft und aufbereitet. Lindemann hatte Lageberichte verfasst und enge Kontakte zur afghanischen Bevölkerung, befreundeten Streitkräften sowie Geheimdiensten gepflegt. Was er über das brisante Thema: „Afghanistan“ zu sagen hatte, interessierte mich sehr. Ich sicherte mir also meinen Platz in der ersten Reihe und wartete zusammen mit zahlreichen weiteren höchst interessierten Zuhörern gespannt auf den Beginn der Veranstaltung. Er werde nicht aus dem Buch vorlesen, stellte Lindemann sogleich klar. Erscheine es ihm doch viel lohnenswerter, einen Vortrag zu halten und währenddessen, wie auch danach, über die Themen zu diskutieren. Zunächst vermittelte der Autor einen Eindruck davon, welche NATO-Mitgliedstaaten im Rahmen der Sicherheits- und Aufbaumission „ISAF“ 2002, infolge der Terroranschläge vom 11. September, militärische Kräfte nach Afghanistan entsendeten und wo im Land diese stationiert wurden. Das Land wurde in sogenannte Regionalkommandos unterteilt. Deutschland entsendete Truppen in den Norden des Landes, in das Regionalkommando Nord. In diesem Gebiet blieb es lange Zeit ruhiger und friedlicher als in den üblichen Landesteilen. Das lag daran, dass die hier lebenden Ethnien nicht diejenigen waren, aus denen sich die Taliban rekrutierten. Überdies hatten die Taliban den Norden, auch vor 2001 schon, nie ganz erobern können. Was aber ist eigentlich der Auftrag der ISAF (International Security Assistance Force)? Welche Ziele werden und wurden mit ihr verfolgt? Formal werde sie zur Unterstützung der afghanischen Zentralregierung durchgeführt, erklärte Marc Lindemann. Die ISAF habe bei der Ausweitung der Autorität der afghanischen Regierung in die Provinzen, bei der Schaffung und dem Erhalt eines sicheren Umfeldes sowie bei der Anwendung der Grundsätze guter Regierungsführung unterstützend wirken sollen. Auf diese Weise habe man die Voraussetzungen für den Wiederaufbau, die Entwicklung und langfristige Stabilität im Land und schließlich den Rückzug von ISAF schaffen wollen. Die Regierung unterstützen und ihre Autorität ausweiten? Lindemann beteuerte, dass die Afghanen den 2001 gewählten afghanischen Präsidenten, Hamid Karzai, heute gemeinhin als Oberbürgermeister von Kabul verspotten würden. Seine Autorität reiche nicht über die Stadtgrenzen hinaus. Wobei und wie also soll die ISAF dieser autoritätslosen Regierung zur Seite stehen? Hier wird bereits ein erstes großes Problem der NATO-Mission ISAF deutlich. Was taten aber nun die Soldaten überhaupt, um die Ziele der ISAF zu verwirklichen? Ihr heutiges Vorgehen und die gesamte Situation vor Ort unterscheiden sich in erheblichem Maße von den Maßnahmen, die in den ersten Jahren in Afghanistan umgesetzt wurden und den damaligen Bedingungen, sagte Lindemann. Er selbst war 2005 und in den Jahren 2008 bis 2009 dort im Einsatz gewesen und berichtete, dass sich das Lager der Soldaten 2005 noch mitten in der Stadt befunden habe und es relativ ungesichert gewesen sei. Heute befände es sich dagegen außerhalb der Stadt und sei durch vielerlei Maßnahmen hochgesichert. Auch habe sich der Arbeitsalltag der Soldaten 2005 noch sehr viel ruhiger und entspannter gestaltet. Schwerpunkt seien Patrouille-Tätigkeiten gewesen. Man bildete Konvois und fuhr ins Land, um dort bestimmte Aufträge abzuarbeiten. Dies lief damals stets friedlich ab und die Soldaten wurden teilweise Fähnchen-schwingend von den Einheimischen in den Dörfern empfangen. Zudem sei die Bedrohungslage damals sehr schwach gewesen. Lindemann erfuhr von kaum einer Miene. Wenn doch, sei diese so harmlos gewesen, dass kaum ein Schaden daraus entstanden wäre. Er habe 2005 einen einzigen Raketenalarm erlebt. Diesem wären jedoch keine Raketen gefolgt. Überdies habe er von keinem einzigen Selbstmordanschlag erfahren. Was geschieht heute in Afghanistan? Es herrsche Krieg, sagte Lindemann. Die Taliban seien zu einer irregulären Armee erstarkt. Die Bundeswehr sei nur noch mit gepanzerten Fahrzeugen im Einsatz. Außerhalb des Lagers spreche man von feindlichem Gebiet und die Soldaten, die hinausfahren würden, könnten sich sehr sicher sein, innerhalb kürzester Zeit angegriffen zu werden, erfuhr ich. Der Feind halte sich an keine Kriegsführungsregeln. Er uniformiere sich nicht, agiere heimtückisch und mit Hinterlist und missbrauche die zivile Bevölkerung, indem er etwa aus Schulen oder Moscheen schieße und dort seine Waffenlager unterhalte. Marc Lindemann: „Die Bundeswehr kann sich ab 2008 nur noch selbst verteidigen“. Dabei waren sie doch ins Land gekommen, um zu helfen. Was ist falsch gelaufen? Welche Fehler sind begangen worden und was kann man wie besser machen? Springen wir gedanklich noch einmal zurück ins Jahr 2005. Welche Aufträge haben die Soldaten damals überhaupt ausgeführt? Marc Lindemann konnte natürlich nur davon berichten, was er selbst erlebt und gesehen hatte. Während der Patrouille-Fahrten ins Land sprach er, und das war seine Hauptaufgabe als Nachrichtenoffizier, mit den Einheimischen. Er fragte nach Problemen. Man habe ihm von Kindesentführungen und Vergewaltigungen, aber auch von Problemen rein baulicher Natur berichtet. Es hätten Gebäude gefehlt und man habe Brücken benötigt. Lindemann erklärte am Mittwochabend, er habe ihnen stets nur eines antworten können. Und zwar habe er sagen müssen: „Dafür sind wir nicht zuständig“. Tatsächlich ist ja auch die Unterstützung der afghanischen Regierung oberstes Ziel der ISAF. Zunächst hätte also die einheimische Polizei um Hilfe gebeten werden müssen. Diese allerdings sei damals wie heute überaus korrupt und aus diesem Grund vollkommen unzuverlässig, erklärte der Autor. Auch hätten die Soldaten keinerlei Mittel besessen, um bauliche Maßnahmen umzusetzen. Man patrouillierte also weiterhin und schrieb, wie Marc Lindemann, viele Lageberichte. Doch wer las diese Berichte überhaupt und was hatte man damit erreicht? Man hatte erreicht, dass die afghanische Bevölkerung mit der Zeit zu der Erkenntnis gelangte, dass diejenigen, die eigentlich ins Land gekommen waren, um ihnen zu helfen, gar nichts ausrichten konnten und dass einfach nichts geschah. Aus dieser Enttäuschung erwuchsen nach und nach natürlich Missmut und Erbitterung. Lindemann: „Es wurde von Beginn an viel zu zögerlich vorgegangen“. Dabei bezog er sich auf militärische wie auch zivile Maßnahmen. Das Militär habe zu wenige Kräfte nach Afghanistan geschickt und anscheinend habe man nach dem Feldzug von 2001 auch gar kein richtiges Konzept darüber besessen, „wer wann was wozu“ tue, erklärte er. Auch beim zivilen Wiederaufbau seien viel zu geringe Mittel eingesetzt worden, weshalb heute kaum Fortschritte zu erkennen seien. Überdies hätte man die Aufständischen von der Zivilbevölkerung trennen müssen. Das heißt, man hätte den Menschen von Anfang an intensiver zeigen müssen, dass es sich lohne, mit der NATO zusammenzuarbeiten, da sie Sicherheit und eventuell einmal einen Arbeitsplatz gewährleisten könne. Menschen nämlich, die ihre Türen aus den genannten Gründen der NATO öffnen würden, würden sie vor Aufständischen verschließen, sagte Lindemann. Dies sei jedoch kaum oder in zu geringem Maße geschehen, meinte er. Was ist nun Marc Lindemanns Lösungsvorschlag? Der ehemalige Nachrichtenoffizier gab zu verstehen, über so etwas, wie eine Generallösung, verfüge auch er nicht. Jedoch könne man versuchen, das, was bisher nicht funktionierte, in eine bessere Richtung zu lenken. Man könne etwa die Machtbefugnis mehrerer regionaler Regierungsvertreter stärken. Zudem müssten deutlich mehr finanzielle Mittel für den zivilen Wiederaufbau eingesetzt werden. Doch, um zu zeigen, dass es sich lohne, mit dem Militär und der NATO zusammenzuarbeiten, sollten militärische und zivile Operationen viel enger koordiniert werden. Denn die Menschen bräuchten eben sofort Hilfe, wenn etwa eine Brücke oder ein Haus zerstört wurde. Während des gesamten Vortrags entbrannten immer wieder heftige Diskussionen. Viele Hörer hatten sich anscheinend schon lange intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es sei ja gar nicht bewiesen, dass die Taliban für die Anschläge am 11. September verantwortlich seien, hörte ich. Amerika habe doch auch afghanische Kämpfer während der russischen Invasion unterstützt. All diese Anmerkungen wurden aufs Heftigste diskutiert. Man sprach zudem über die sogenannten Warlords. Kriegsanführer, die bis heute in Afghanistan herrschen. Sie wurden während des Feldzuges der NATO unterstützt und kämpften mit dieser 2001 gegen die Taliban. Wie aber, fragte Lindemann, könne man für Stabilität im Land sorgen, wenn man gleichzeitig solche Kriegsverbrecher unterstütze? Auch über die afghanische Kultur wurde diskutiert. Kann man beispielsweise respektieren, dass Frauen in Afghanistan kaum ein selbstbestimmtes Leben führen können? Der Zwang ihrer ständigen Verschleierung ist meiner Meinung nach, noch das geringste Problem. Viel grausamer und verachtungswürdiger sind doch die vielfach stattfindenden Vergewaltigungen im Land und die Tatsache, dass es in Afghanistan gang und gäbe ist, neunjährige Mädchen mit Greisen zu vermählen. Auch kann man sich ja fragen, ob es überhaupt möglich ist, mit Waffenkraft Frieden zu stiften. Die Terrorismus-Debatte, die Waffenlager und Mohnfelder Afghanistans sowie die Weltmacht Amerika wurden angesprochen. Eine unglaublich komplexe Thematik. Der Untertitel des Buches: „Warum Deutschland in Afghanistan scheitert“, lässt vermuten, Marc Lindemann befürworte den Abzug deutscher Soldaten aus Afghanistan und ein Scheitern dort sei seiner Meinung nach so oder so vorprogrammiert. Das Gegenteil aber ist der Fall. Er vertritt die Meinung, man solle unbedingt im Land bleiben und die Mission weiterführen. Lindemann: „Ich sehe einfach keine andere Wahl. Wenn etwas nicht gut ist, dann kann ich es gut machen und gehe nicht.“ Wer mehr über das Thema und Marc Lindemanns Buch erfahren möchte, kann sich auf der Website zum Buch ausführlicher informieren.
16. Mai 2010 | Weiterlesen
Beachvolleyball: Inchez-Cup in Warnemünde
Alles war bereit am heutigen Samstagmorgen in Warnemünde, bereit zum Start in die neue Beachvolleyball-Saison. Die Spielfelder, insgesamt 24 an der Zahl, waren aufgebaut und die Sportler zahlreich erschienen. Insgesamt 1.500 Euro Preisgeld warteten auf die Siegerduos. Es sollte der Auftakt zu den Landesmeisterschaften Mecklenburg-Vorpommerns werden, dem ersten von insgesamt acht Ranglistenturnieren in diesem Jahr. Alles war bereit, außer dem Wetter. Bei kühlen 8°C, Regen und Wind musste das Turnier leider abgesagt werden. Die Entscheidung darüber wurde von den Volleyballern und Volleyballerinnen selbst getroffen. Das Reglement schreibt vor, dass das Turnier wetterbedingt abgesagt wird, wenn mehr als die Hälfte der gemeldeten Mannschaften für den Abbruch stimmen. Mit einem Verhältnis von etwa 70 Nein- zu 40 Ja-Stimmen fiel die Entscheidung eindeutig aus. „Es ist schade, besonders für die Teams, die von weiter weg angereist sind“, meinte Steffen Bock, Vorsitzender des Organisators Active Beach e.V. im Hinblick auf die Mannschaften aus Hamburg oder Berlin. Angemeldet hatten sich 67 Herren- und 44 Frauenteams. Mit dabei waren bei den Herren auch die Titelverteidiger aus dem Vorjahr. Viele der gemeldeten Teams waren bereits am Donnerstag beim „Hello-Again-Quadro-Turnier Warnemünde“ anwesend, um sich schon einmal auf das Ranglistenturnier einzustimmen. Das nächste Ranglistenturnier findet am 12. und 13. Juni in Neustadt-Glewe statt. Weitere Turniere folgen in Graal-Müritz, Freest, Greifswald, Ückeritz und Karlshagen. Das Saisonfinale wird dann im August wieder in Warnemünde ausgetragen. „Nächste Woche versuchen wir es noch einmal mit dem An-Bagger-Cup“, gibt sich Steffen Bock optimistisch. 144 Mannschaften haben sich für dieses Turnier bereits angemeldet. Bleibt für die Sportler nur zu hoffen, dass sich das Wetter dann von einer besseren Seite zeigt.
15. Mai 2010 | Weiterlesen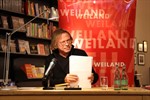
Volker Lechtenbrink - Autobiografie bei Weiland
Volker Lechtenbrink zu Gast in Rostock – am Montag wurde er zur Lesung seiner Autobiografie bei Weiland erwartet und dies nicht nur von mir, wie ich noch vor Beginn der Veranstaltung feststellen durfte. Ich erschien zwar schon 40 Minuten vor der Zeit in der Buchhandlung, doch waren schon etwas mehr als die Hälfte der 200 bereitgestellten Stühle von Fans des Künstlers in Beschlag genommen worden. Letztlich verwundert diese Tatsache nicht, da Volker Lechtenbrink auf viele Jahrzehnte eines künstlerischen Schaffens zurückblicken kann. Und was hat der 66-jährige bis heute nicht schon alles gemacht! Neben zahlreichen Engagements an Theatern als Bühnenschauspieler, arbeitete er selbst auch als Intendant, wirkte in Fernsehfilmen mit, führte Regie in Filmproduktionen, war erfolgreicher Schlagersänger und dazu noch Synchronstimme von Schauspielern wie Kris Kristofferson und Burt Reynolds. Weiterhin nahm er Hörspiele auf (auch für Kinder) und spricht bis heute Dokumentationen im TV. Sein Markenzeichen ist seine unverwechselbare Stimme, an der man Lechtenbrink sofort erkennen kann, ohne ihn zu sehen. Nun war er da. Gleich zu Beginn höflicher Applaus von allen Sitzplätzen. Alle besetzt natürlich. Lechtenbrink begrüßte sein Publikum und dankte zwei Rostockerinnen, die ihn zuvor vor der alten Weiland-Filiale in der Kröpeliner Straße abfingen und zur neuen mitnahmen. Er hatte sich noch eben die Rostocker Innenstadt angeschaut und resümierte, dass Rostock eine tolle Stadt sei. Die Idee zu einem Buch trug Lechtenbrink schon einige Jahre in sich. Immer mal wieder machte er sich seit frühester Jugend Notizen auf Zetteln. Darauf unterschiedlichste Begebenheiten, Anekdoten und Geschichten zu Künstlerkollegen, Prominenten und seinen Familienmitgliedern. Als er mit Intendant und Regisseur Jürgen Flimm in einem Auto im Stau feststeckte, wussten sich beide so Einiges an Anekdoten über künstlerische Weggenossen zu erzählen. Lechtenbrinks ehemalige Frau, Jeanette Arndt, riet ihm, sein Buch zu schreiben, was er dann auch in die Tat umsetzte. Herausgekommen sei dabei „ … eine Mischung aus Erinnerung und Biographie“, die nicht chronologisch geschrieben ist, dafür sprunghaft und temperamentvoll zu unterhalten weiß. Der Einstieg ins Buch. Volker Lechtenbrink liest das Kapitel an, in dem es um seine Zeugung geht. Der Vater schwängert seine Ehefrau, um diese vor der drohenden Einberufung in eine Munitionsfabrik zu bewahren. Mit Erfolg. Am 18. August des Jahres 1944 erblickt ihr Sohn Volker das Licht der Welt. Zehn Tage später schon flieht die Familie aus Ostpreußen in Richtung Bremen. Es folgt eine Schilderung, in welcher der Autor seine ganze Verehrung für den Vater Ausdruck verleiht. Mit den Augen des damaligen kleinen Jungen Volker liest er die Szene, in der Lechtenbrink Senior seinem Sohn ein Fahrtenmesser auf dem Bremer Freimarkt, einem Rummelplatz, ergattert. Mit viel Witz und voll Herzenswärme geschrieben und vorgetragen. Das Rostocker Publikum biegt sich dabei vor Lachen, klatscht enthusiastisch Beifall. Lechtenbrink schildert in Anekdoten seine Zeiten am Hamburger Johanneum und an der dortigen Hochschule für Musik und darstellende Kunst. In „Die Brücke“, einem Antikriegsfilm von Regisseur Bernhard Wicky, bekommt er seine erste Rolle in einem Film. Als Vorbild gibt Lechtenbrink Hansi Lothar an, mit dem er seinerzeit arbeiten durfte und der ihn stark beeindruckte. Als dieser mit 37 Jahren stirbt, steht für Volker Lechtenbrink fest, dass er auch nicht älter werden wolle. Mit immer geringer werdendem Abstand zu diesem Lebensalter, muss er allerdings erkennen, dass er doch sehr am Leben hängt und dies ist auch ein Grund, warum er seinen Mitmenschen so viel Freude bereitet. Hier ist Einer, der das Leben liebt und sich trotz Schwierigkeiten, immer wieder aufrafft, um weiterzumachen. Seinen Familien oder besser seiner „Patchworkfamilie“ sind mehrere Kapitel gewidmet, in denen er von aufgetretenen Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Scheidungen, erzählt und immer wieder das gemeinsam verbindende Element, die Nächstenliebe, beschwört. In den folgenden Auszügen liest der Autobiograph bei Weiland von seinen Erlebnissen mit großen Schauspielkolleginnen und -kollegen. Er erzählt vom Aufeinandertreffen mit Robert de Niro, der ihn nur „Wolka“ nennt, und ihrem morgendlichen Ritual an zwei Balkonfenstern in einem New Yorker Hotel. Wie er als Entertainer der TV-Show „Life. Volker Lechtenbrink.“ Anthony Quinn als Interviewpartner gewinnen konnte und warum er Schauspielerin Nadja Tiller anfangs sehr schüchtern gegenüber trat. Von Lechtenbrink verehrte Kollegen wie Horst Frank, Walter Giller, Hildegard Knef, Monika Bleibtreu und Dirigent Horst Kleiber werden mit besonderer Aufmerksamkeit im Buch bedacht. Die Rostocker jedenfalls wurden prächtig unterhalten. Da wurde geklatscht und gelacht bei fast jeder seiner Pointen. Schließlich konnten Fans noch ein paar drängende Fragen loswerden, die Volker Lechtenbrink geduldig beantwortete. Mit dem Signieren des bei Hoffmann und Campe erschienen Buches endete die Lesung nach zwei Stunden. Ein Allroundtalent zog hier (Zwischen-)Bilanz.
14. Mai 2010 | Weiterlesen



