Beatrice von Weizsäcker: Die Unvollendete
Lesung zum Thema „Deutsche Einheit“ in der Universitätsbuchhandlung Weiland
19. November 2010, von Phillip
„Umfrageschock: Jeder vierte wünscht sich die Mauer zurück“, so titelte die Bild-Zeitung im März diesen Jahres. Anlass der Umfrage war der zweiteilige Sat 1 Spielfilm „Die Grenze“, der im Frühjahr ausgestrahlt wurde. Auch wenn die Umfragewerte sicherlich fragwürdig sind, so drückt sich darin doch aus, dass die innerdeutsche Einheit auch zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung von Ost und West zwar auf dem Papier, nicht aber in den Köpfen wirklich aller Bundesbürger abgeschlossen ist.
Um das Thema „Deutsche Einheit“ geht es auch in Beatrice von Weizsäckers neuem Buch „Die Unvollendete“. Dieses stellte die Tochter des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am Donnerstagabend in der Universitätsbuchhandlung Weiland vor. Inhaltlich ist das Buch in die folgenden drei Teile gegliedert:
- Damals: Vereint! Verhöhnt?
- Heute: Vereint! Versöhnt? – Eine Spurensuche
- Morgen: Vereint! Versöhnt!

Im Vorwort wird aber zunächst ein Vergleich mit den Südstaaten in den USA nach dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert angestellt. Auch über 100 Jahre später spüre man dort noch die Folgen der Abspaltung und anschließenden Wiedereingliederung in die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Kriegsende.
Die Südstaatler mussten nicht nur die schmerzliche Niederlage verkraften, sondern fühlten sich auch aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche unterlegen. Bis in die 90er Jahre hinein blieb man Nordstaatlern gegenüber misstrauisch und hielt sie für arrogant. Nicht gerade ermutigende Aussichten!

Im Folgenden wird deshalb der Frage nachgegangen, wie weit der Prozess der Vereinigung in Deutschland fortgeschritten ist und ob es sich tatsächlich um ein Volk handelt.
Beispiele aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Sport oder Kunst werden ausführlich erläutert, so auch die Ausstellung „60 Jahre, 60 Werke“. Diese ist alles andere als ein leuchtendes Beispiel von Einheit, im Gegenteil. Die Idee dahinter war es, zum 60. Geburtstag des Grundgesetzes für jedes Jahr ein Werk eines Künstlers auszustellen. Allerdings wurde kein einziger Künstler ausgewählt, der vor 1989 in der DDR gelebt und gearbeitet hatte. Lediglich Künstler wie A. R. Penck, die lange vor dem Mauerfall in den Westen gegangen sind, wurden berücksichtigt.
Die Begründung lautete, dass in einer Diktatur keine Kunst und Kultur gedeihen könne. Aber entstehen nicht gerade unter widrigen Umständen mitunter die besten Werke? Ein Schlag ins Gesicht in jedem Fall für jeden Künstler, der in der ehemaligen DDR aktiv war.

Teilweise erweckte die Lesung trotz aller Notwendigkeit, den Finger auch einmal in die Wunde zu legen, dann doch den Eindruck, als ob die Autorin bewusst das Trennende sucht und es dem Verbindenden, Gemeinsamen vorzieht. Wodurch phasenweise der Eindruck entstehen konnte, dass irgendwie alles schlecht war seit der Wiedervereinigung.
Positives? Fehlanzeige, von den Städtepartnerschaften wie beispielsweise zwischen Rostock und Bremen einmal abgesehen, aber die existierten ja auch vorher schon und sind nicht unbedingt ein Verdienst der Wiedervereinigung.
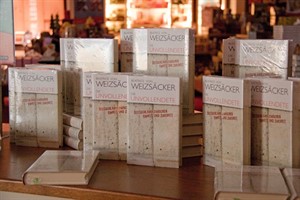
Immerhin stellte Beatrice von Weizsäcker an das Ende ihrer Lesung ein positives, praktisches Beispiel, wie Versöhnung aussehen kann, und beruhigte damit auch etwas die Gemüter des einen oder anderen Zuhörers, die sich im Laufe des Abends zum Teil ein wenig erhitzt hatten.
Dabei führte sie Uwe Holmer an, der es war, der Erich Honecker und dessen Frau in seiner eigenen Wohnung Asyl gewährte, nachdem diese durch das Ende der DDR obdachlos geworden waren. Und das, obwohl Holmer keine leichte Zeit in der DDR gehabt hatte. Dennoch war es für ihn selbstverständlich, dass er als Christ nicht beten könne „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ und dann anschließend nicht danach zu handeln.
Ein ermutigendes Beispiel gelebter Versöhnung. Vielleicht ist es ja doch möglich auch in weniger als 100 Jahren vereint und versöhnt zu sein.
 „Sie & Er“ von Eva Gritzmann und Denis Scheck
„Sie & Er“ von Eva Gritzmann und Denis Scheck  Hellmuth Karasek erzählt (über) Witze in Rostock
Hellmuth Karasek erzählt (über) Witze in Rostock Martin Mosebach: „Was davor geschah“
Martin Mosebach: „Was davor geschah“ „AIDAmar“ eröffnet Kreuzfahrtsaison 2025 in Rostock-Warnemünde
„AIDAmar“ eröffnet Kreuzfahrtsaison 2025 in Rostock-Warnemünde Osterfeuer, Ostermarkt und Saisonstart am Leuchtturm in Warnemünde
Osterfeuer, Ostermarkt und Saisonstart am Leuchtturm in Warnemünde Korvette „Braunschweig“ im Stadthafen Rostock
Korvette „Braunschweig“ im Stadthafen Rostock Havarie des Fahrgastschiffes „MS Baltica“ vor Kühlungsborn
Havarie des Fahrgastschiffes „MS Baltica“ vor Kühlungsborn Eye 55 - XXL-Riesenrad in Warnemünde
Eye 55 - XXL-Riesenrad in Warnemünde Rostocker Warntag mit Sirenen-Test am 5. April 2025
Rostocker Warntag mit Sirenen-Test am 5. April 2025 Neues Bettenhaus fürs Südstadt-Klinikum
Neues Bettenhaus fürs Südstadt-Klinikum Forschungsprojekt: Autonome Warnow-Fähre
Forschungsprojekt: Autonome Warnow-Fähre



