Stirbt der Ländliche Raum in Europa?
Podiumsdiskussion anlässlich der EUROPA-Tage an der Universität Rostock
29. Oktober 2010, von Olaf
Stirbt der Ländliche Raum in Europa? Kurze Frage, kurze Antwort: Nein, er stirbt nicht. So zumindest lautete das einhellige Fazit bei der gestrigen Podiumsdiskussion an der Universität Rostock.
Etwas mehr gab es in der gut zweistündigen Veranstaltung natürlich schon zu erfahren. Die Ursachen für Probleme im Ländlichen Raum sind ganz klar bei der negativen Bevölkerungsentwicklung zu suchen, erläuterte Professor Dr. Gerald Braun vom Hanseatic Institute for Entrepreneurship & Regional Development (HIE-RO). Und hier gibt es ein deutliches Ost-West-Gefälle: „Die großen Schrumpfungsraten liegen in Mittel- und Osteuropa.“

Betroffen seien vorwiegend die ländlichen Gebiete. Hinzu kommt die Abwanderung der jungen Leute in die Städte. „Wenn die Schule stirbt, stirbt das Dorf“, heißt es in Zypern. „Ich bin entsetzt“, klagt Braun, „wie man dem Sterben der Schulen zugekuckt hat.“
Was aber kann man tun? Passivsanierung sei eine Strategie, erläutert der Professor. Frei nach dem Motto, Reisende kann man nicht aufhalten, die Abwanderung in Kauf nehmen und für die Alten, die „Fußkranken der Völkerwanderung“, eine soziale Grundsicherung bereitstellen.
Stabilisierung sei die zweite Strategie, wobei Braun gar nicht von Wachstum reden wollte, das es vereinzelt auch im Ländlichen Raum durchaus gibt. Erfolgreich könne diese Strategie nur sein, wenn die urbanen Zentren im Ländlichen Raum gestützt werden – die sogenannte Oasenstrategie.

Oasen fördern, statt nach dem flächendeckenden Gießkannenprinzip Wüsten zu bewässern, sei angesagt. Ankerstädte, wie Stralsund oder Greifswald, könnten die Abwanderung zumindest bremsen, sodass die „Leute nicht gleich bis New York laufen“, stellt Braun es etwas überspitzt dar.
Da dürfte natürlich immer noch viel Platz für Wüstengebiete bleiben – wer knipst das Licht aus?
Es klinge zwar schrecklich, so Braun, doch „diese Wüsten würde ich einer Passivsanierung überlassen. Das regelt sich von selbst.“
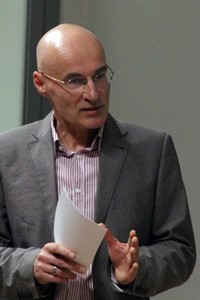
Ob denn analog zu den Rückbauprogrammen in Städten auch ähnliche Initiativen für den Ländlichen Raum vorgesehen seien, wollte Dr. Ulrich Vetter, Moderator des Abends wissen.
Noch nicht, stellte Lutz Scherling vom Landwirtschaftsministerium MV klar. Bisher gibt es nur eine Art „Schandfleckenbeseitigungsprogramm“. Ein Rückbauprogramm für den Ländlichen Raum wäre aber durchaus wünschenswert, so Scherling. Momentan würde man im Land aber eher darum kämpfen, das Städtebauprogramm überhaupt zu erhalten.
Doch, wo stehen wir im EU-Vergleich denn bei der Entwicklung des Ländlichen Raumes überhaupt?
Verglichen mit Polen oder dem Baltikum stünden wir mit unserer Infrastruktur ganz gut da, erläuterte Werner Kuhn (CDU), Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Mit Blick auf Skandinavien wären wir aber doch nur Mittelfeld.
„Wenn wir uns gut fühlen wollen, schauen wir Richtung Osten, wenn wir ein Ziel brauchen, nach Norden“, fasste es Vetter etwas salopp zusammen.

Was macht man aber nun konkret im Ländlichen Raum? Die Schaffung mobiler Dienstleistungen sei ein wichtiges Thema, so Braun: „Die Krankenschwester, die einmal in der Woche ins Bürgerhaus kommt. Die Bücherei mit Videos und CDs, die einmal in der Woche ins Bürgerhaus kommt. Der Arzt, der einmal in der Woche Sprechstunden hat. Vielleicht auch der Pfarrer, der einmal in der Woche die Leute beerdigt.“
Wer von den jungen Leuten würde denn freiwillige aufs Land gehen, kam ein Einwand aus dem Publikum. Wer würde denn sagen, „ich freue mich aufs Frischemobil am Donnerstag, ich freue mich auf das Zeltkino auf dem Dauercampingplatz?“ Da würde es wohl doch an jungen Leuten fehlen, die das mitgestalten wollen.

Eine provokante These gab es zum Abschluss auch noch, allein schon, damit der Abend nicht gar zu harmonisch verläuft.
„Die Fischer sind ihre eigenen Totengräber“, erklärte Michael Popp von der EU-Kommission auf eine Publikumsfrage nach den Fangquoten. „Das ist von der Nationalität her völlig unabhängig“, führte er weiter aus.
Angesichts der gerade erst für unseren Ostseeraum erneut deutlich herabgesetzten Heringsquote mag sich der eine oder andere Zuhörer verdutzt die Augen gerieben haben. Und hatte nicht Dr. Cornelius Hammer, Leiter des Instituts für Ostseefischerei (IOR), erst kürzlich beim Besuch der Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner klar festgestellt, dass die hiesigen Fischer an den Rückgängen der Bestände keine Schuld träfe?

Werner Kuhn, auch Mitglied im Fischereiausschuss, konnte da nur heftig widersprechen. Die Wissenschaftler des IOR würden den Küsten- und Kutterfischern unseres Landes genaue Vorgaben machen, welche Fanggrößen mit einer nachhaltigen Fischerei verträglich sind. Bei den nochmals gesenkten Heringsquoten würden einige Fischer nun „den Schlüssel rumdrehen und Schluss machen.“ Jetzt seien Übergangszahlungen aus dem Fischereifond notwendig, damit die kleinen Fischereibetriebe nicht kaputt gehen – für Kuhn auch Oasen, die bewässert werden müssen.
Zurück zum Fazit der Runde: Der Ländliche Raum wird sich verändern, aber nicht sterben, da waren sich die Teilnehmer einig. Nur Professor Braun war sich in diesem Punkt nicht ganz sicher, aber immerhin hofft er doch, „dass diese Art von Diskussion nicht sterben wird.“
 Wissenschaftsspielplatz „Eureka“ zu Gast in Rostock
Wissenschaftsspielplatz „Eureka“ zu Gast in Rostock Bundespräsident Wulff begrüßt Erstsemester an der Uni
Bundespräsident Wulff begrüßt Erstsemester an der Uni Neue Forschungsgebäude auf dem Südstadtcampus
Neue Forschungsgebäude auf dem Südstadtcampus Neues Bettenhaus fürs Südstadt-Klinikum
Neues Bettenhaus fürs Südstadt-Klinikum Forschungsprojekt: Autonome Warnow-Fähre
Forschungsprojekt: Autonome Warnow-Fähre Verhandlungsergebnis im ÖPNV-Tarifstreit in MV
Verhandlungsergebnis im ÖPNV-Tarifstreit in MV Kröpeliner Tor nach Fassadenschäden vorerst gesperrt
Kröpeliner Tor nach Fassadenschäden vorerst gesperrt Goetheplatzbrücke - Verkehrsfreigabe im Mai
Goetheplatzbrücke - Verkehrsfreigabe im Mai Feuerwehr Rostock stellt Jahresbericht 2024 vor
Feuerwehr Rostock stellt Jahresbericht 2024 vor ÖPNV-Streik: Notfahrpläne bei RSAG und Rebus
ÖPNV-Streik: Notfahrpläne bei RSAG und Rebus Straßenbaustellen 2025 in und um Rostock
Straßenbaustellen 2025 in und um Rostock



